»Wir sind noch hier« heißt Sarah Riedebergers Blog, auf dem sie über L{i}eben, Sterben, Tod und Trauer schreibt und mich mit ihren Texten immer wieder aus meiner wohlsortieren Wirklichkeit reißt. Denn zum Thema L{i}eben mag ich noch einigermaßen sprachfähig sein, doch wenn’s ums Sterben, um den Tod und die Trauer geht, fehlen mir oft die Worte. Vielleicht auch, weil ich dem Ende des Lebens noch nie wirklich nah war. Ganz anders Sarah, die ihren Vater als junge Erwachsene in den Tod begleitete und ihren Schwager sterben sah.
Im heutigen Interview geht um diese Erfahrungen und wie sie ihre Sicht auf das Leben verändert haben. Hab‘ vielen Dank, liebe Sarah, für dieses intensive, aufwühlend-schöne Gespräch, mit dem ich allen eine gute erste Aprilwoche wünsche.

Du schreibst, deine Biographie sei wirr und nebensächlich, es gäbe nicht viel über dich zu sagen. Warum?
Ich halte Biographien allgemein für nebensächlich. Das hat gar nichts mit mir persönlich zu tun. Detailreiche Schilderungen über einen Werdegang langweilen mich sehr, weil das für mich nicht das ist, was jemanden ausmacht. Vielleicht eher: »Machst und bist du das, was du willst?«
Aber ich würde zum Beispiel nie so was sagen wie: »Mich würde ja brennend mal interessieren, was du für ein*e Schüler*in warst, verrätst du es mir?« Weil mich das einfach überhaupt nicht interessiert. Zumindest nicht so. Ich lerne gerne die Geschichte kennen, die hinter einem Gesicht oder einem Hochschulabschluss steckt. In dem Text »Was hält uns eigentlich aus?« habe ich dieses Thema auch mal angerissen. Denn es fällt mir zum Beispiel selbst schwer, nur die zu sein, die schreibt, wenn nicht gefragt wird: Worüber.
Das Wenige, das dann noch sagbar ist, wovon handelt das?
»Just a smalltown girl, living in a lonely world.« Das beschreibt mich schon sehr gut. Aber ich bin auch das sechste und letzte Kind einer Großfamilie. Eine Tatsache, die mir in meiner Kindheit von anderen nachteilig ausgelegt wurde und durch Sprüche wie: »Hatten deine Eltern keinen Fernseher?« oder» Und ihr seid echt ALLE vom gleichen Vater«, nicht selten ein schlechtes Gefühl gaben. Ich hatte oft das Bedürfnis mich für meine Familie zu schämen und mich für meines und das Leben von fünf weiteren Menschen, die ich liebe, rechtfertigen zu müssen. Heute bin ich sehr glücklich darüber.
Ich habe zum Beispiel meinen Teamgeist vom familiären Partnercanasta, bei dem es vorrangig um Zeitvertreib und Vergnügen ging – nicht vom Mannschaftssport.
Ich habe ein sehr ausgeprägtes Gespür für Befindlichkeiten entwickelt und kann ziemlich gut auf Menschen eingehen, ihnen Mut zu sprechen oder Pflaster auf Wunden kleben. Als letztes Kind ist man nicht immer das verwöhnte Nesthäkchen, man ist eigentlich jemand, der mit am Tisch sitzt und die Probleme der Großen aufsaugt wie ein Schwamm, Gestik und Mimik studiert, der sensibilisiert ist für Gefühlslagen und der es ziemlich geil findet, viel zu große Klamotten zu tragen.
Manchmal frage ich mich auch, wie dieses riesige Herz, das ich habe, in meinen kleinen Körper passt und warum viele glauben ich sei nicht fröhlich oder lustig, nur weil ich mich mit dem Tod beschäftige. Denn ich bin fröhlich und lustig, verhältnismäßig oft sogar albern.
Deine Auseinandersetzung mit dem Tod erwuchs aus einer Art Todessehnsucht, die sich in eine Lebenssehnsucht verwandelt hat, erzählst du auf »Projekt [Sterbenswörtchen]«. Was zeichnet diese Sehnsüchte aus, wo ähneln und wo unterscheiden sie sich?
Das mit den Sehnsüchten ist eine komplizierte Sache und daher auch gar nicht so einfach zu erklären. Eine Sehnsucht ist ja eigentlich nur ein Vakuum in uns, das wir dringend mit irgendwas füllen wollen, eine Leere stopfen, wie ein hässliches Loch in der Wand. Ich bin sehr froh, dass ich meinem ersten Drang, der Todessehnsucht, nie nachgekommen bin, sondern diese ausgehalten habe. Die Lebenssehnsucht ist im Vergleich dazu ein sehr schönes Gefühl. Es war ein schleichender Prozess von der einen zur anderen Sehnsucht.
Wieso soll ich leben, wenn ich es morgens schon nicht aus dem Bett schaffe? Was hält mich hier auf der Welt eigentlich, wenn ich nicht hinter den Leuten, die ich toll finde und bewundere, herkomme? Wenn die Vorhänge vergilben, wenn ich es nicht mal mehr schaffe, mir die Nase zu putzen, weil ich zu schwach bin? Das waren alles so Fragen, die ich mir früher gestellt habe. Immer den Blick auf das bessere Leben, und immer die Gewissheit im Kopf, das niemals zu erreichen.
Ich lag unter einer Regenwolke im Matsch und die anderen saßen in der Sonne, die Füße im Meer. Die einen hatten Schmetterlinge im Bauch und ich den Tod in Gedanken.
Lustigerweise hatte ich als Teenager aber latent Hoffnung. So eine naive Idee eigentlich, dass ich das Grau und die Schatten nur solange aushalten müsste, bis ich vierzig sei. In dem Alter, so glaubte ich, seien alle viel gelassener. Wie mir auch andere attestierten, war neben Ausdauer und »ein paar Zielen«, ein bisschen Lockerheit, genau das, was mir angeblich fehlte. Die Sache war nur: Das Streben nach Zielen schürte meine Todessehnsucht zusätzlich.

An diesem Punkt unterscheiden sich die Sehnsüchte deutlich voneinander: Mein Drang nach Leben beruht nicht auf dem Wunsch etwas erreichen zu wollen oder gar müssen. Paradoxerweise kam diese Einsicht als der Tod dann echt in mein Leben trat. Nicht in Form einer Sehnsucht, sondern er war so ganz da und anders, als ich ihn mir immer vorgestellt hatte. Und mit ihm kamen Aufgaben auf mich zu, von denen ich immer geglaubt hatte, ich könne sie erst in zwanzig Jahren wirklich gut: ein Elternteil baden oder anzuziehen oder sterben sehen.
Aber wir Menschen sind zu allem in der Lage, wenn es drauf ankommt, egal, wie alt oder kaputt wir innerlich sind. Einmal habe ich mit meinem Neffen meinen Vater eingecremt. Der Kleine hat das mit einer solchen Gelassenheit gemacht, dass ich dachte, wieso soll ich vierzig werden, wenn der die Ruhe schon mit vier weg hat?
Während mein Vater im Sterben lag, erkrankte dann auch noch mein Schwager an Krebs. Wenn er mir beim Essen gegenüber saß, dachte ich immer: »Scheiße, wie schafft der das nur, ich würde an seiner Stelle eher sterben.« Aber der hat gekämpft; er war so lädiert und abgemagert, hat so viel ausgehalten und irgendwann dann doch erfahren, dass es das mit seinem Leben war. Da war er 47 Jahre alt.
Seine letzten Monate hat er {wie mein Vater} genossen, soweit es ihm möglich war – und ich dachte: »Wenn er in diesem Alter gestorben ist, kann ich mit dem Leben nicht warten bis ich vierzig bin. Ich muss das jetzt einfach machen.« In diesem Moment habe angefangen meinen Blick nicht mehr darauf zu richten, was ich nicht kann, sondern darauf was andere schaffen, aber keiner wahrnimmt.
Man muss sich das nämlich mal vorstellen: Es gibt Sterbende, die leben, als wäre es das Leichteste der Welt. Wieso genießen wir nicht die Zeit, die wir haben? Wir sind schließlich auch potenziell Sterbende. Nur hat uns das noch keiner so deutlich gesagt.
Meine Lebenssehnsucht ist das Resultat meiner Beobachtungen. Zu leben bedeutet heute für mich, die Zeit zu verschwenden, am besten mit Dingen, die mich glücklich machen, wie knutschen, essen, lesen, tanzen, trinken, singen {schief}, Blumen pflanzen usw.

Woher rührt(e) deine Todessehnsucht?
Das Wort Todessehnsucht ist romantisiert und bedeutet nicht viel weniger als Suizidalität. Was sich anfänglich anfühlte, wie im eigenen Körper gefangen zu sein und nichts sagen und nichts tun und nichts ändern zu können, wurde mehr und mehr zu einem Wahnsinn. Das durchzog meine ganze Jugend und weiter. Hinzu kamen die üblichen Probleme in der Adoleszenz und dass mein Vater erkrankte. Da stand ich dann als 18-jährige. Ich hatte viele therapeutische Möglichkeiten ausgeschöpft und nahm Antidepressiva, aber letztlich musste ich meine eigene Kraft aufwenden, um mich quasi aus meinem Körper, sprich der Dunkelheit zu ziehen.
Man könnte meinen, dass die Krankheit meines Vaters einfach meine Krankheit relativiert hätte, Krebs vs. Depressionen, aber so einfach ist das nicht. Es war ein dauerhafter Kampf zwischen Leben und Tod, sowohl bei ihm als auch bei mir. Das war eine Doppelbelastung für mich, so labil und wackelig wie ich in meiner Persönlichkeit war, das setzte mir echt zu. Ich hatte damals seine Medikamente bei mir liegen und die Verantwortung, sie ihm regelmäßig zu geben.
Oft saß ich da, den Kopf voller Schmerzen und rasender Gedanken und dann kam mir die Frage in den Sinn, ob nicht einfach endlich alles vorbei wäre, wenn ich diese verdammten Pillen jetzt schlucken würde. Dann wäre ich tot und das wäre doch das Beste. Aber ich nahm sie nicht, denn ich machte mir immer und immer wieder klar, dass diese Tabletten meinen Vater am Leben halten. Ich könnte sie unmöglich schlucken, um zu sterben.

Das war echt eine krasse Zeit. Dass ich mich selbst bei all dem nicht ganz aus den Augen verloren habe, finde ich heute sogar ein bisschen verrückt.
Ich habe mich und meine Handlungen sehr oft und sehr eindringlich reflektiert, ich habe MIR zu gehört und das hat mir wirklich geholfen. Auf seinen Körper zu reagieren, das zu tun, was man sich selbst zumuten kann, aufhören, wenn es nicht mehr geht und nach seinen eigenen Mustern und nicht der Schablone einer Gesellschaft zu leben, das war vielleicht mein einziges Glück.
Mir blieb ja ohnehin wenig übrig. Die Leute in meinem Alter hatten damit zu tun, sich mit entzündeten Piercings und der Liebe rumzuärgern, während ich ins Krankenhaus fuhr, Tabletten stellte oder mir einredete, dass das irgendwann anders wird, dass irgendwann alles gut werden wird. Da waren keine Ansprechpartner/innen oder jemand, der mich auch nur halbwegs verstand. Seither weiß ich um meine eigene Stärke. Es kommt am Ende niemand und sagt: Das hast du alles ganz toll gemacht. Ich musste mir schon selbst darüber klar werden.
Durch das Erlebte habe ich ein paar Eindrücke davon erhalten, was Leid ist und daraus viel Gutes gezogen. Ich weiß, das Leben ist manchmal scheiße, aber sterben ist viel beschissener. Das kommt früh genug, und zwar dann, wenn es Zeit ist. Ich habe die Entscheidung also aus der Hand gelegt, denn um es mal ganz salopp zu sagen, es ist mir dauerhaft einfach zu viel Verantwortung. Für den Augenblick ist alles gut, wie es ist. Und ich bin froh, das jetzt im Alter von 27 – endlich oder schon – sagen zu können.

»Ich glaube, schreiben macht für mich die Komplikationen im Leben aushaltbar«, schreibst du auf Neon Wilderness. Was macht das Leben so kompliziert und warum wird es schreibend erträglicher?
Wenn die Möglichkeit, wirklich mal offen und ehrlich mit jemanden über alles zu reden, nicht gegeben ist, dann bleibt wenig. Aber so ein weißes Blatt ist da. Das Dokument sagt nicht: »Geh frische Luft schnappen, dann geht’s dir besser.« Es sagt nicht, dass das der Lauf des Lebens ist und es jedem mal beschissen geht. Ein Blatt Papier schaut weder betreten noch weg. Es ist einfach da. Dauerhaft. Es hat keine Angst vor dem, was da kommt, keine Angst vor Ehrlichkeit oder Irrsinn.
Es wäre total falsch zu behaupten, dass mich das Schreiben gerettet hat, denn ein Blatt ist ein Blatt und kein Held, aber es hat mir einen Zugang zu den Gegebenheiten geschaffen und mir immer Halt gegeben, wie ein Freund, in den schwersten Zeiten meines Lebens. Leid ist verbindend und deswegen schreibe ich heute noch. Nur ein bisschen anders.

Stell dir vor, du wachst morgen auf und alles wäre gut – was wäre anders als gestern?
Ich glaube ja, dieses »gut« als Dauerzustand wird ein bisschen zu ernst genommen. Das ist wie mit der Unsterblichkeit. Aber wäre nicht alles total uninteressant, wenn es für die Ewigkeit wäre? Ich habe mich damit arrangiert, dass »gut« meistens einen Moment beschreibt. Und nur, weil etwas vielleicht gerade nicht supergut ist, bedeutet das ja nicht gleichzeitig, dass es schlecht ist.

Alle Fotos: Sarah Riedeberger via Instagram
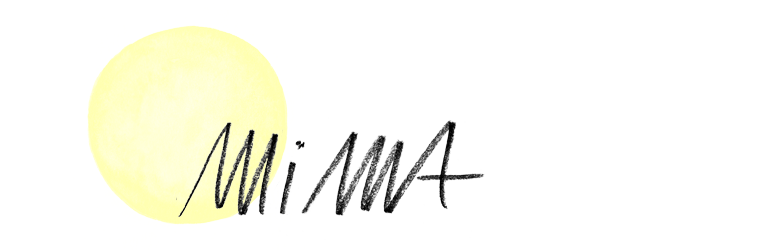


„Wir sind noch hier“ ist diese eine Perle unter den Blogs, die ich lese. Erstaunlich, dass man sich so verstanden fühlen kann.
Hallo Sarah, ich weiss nicht, aber ob ich in Deinen jungen Jahren über Deine Weisheit verfügt habe … ? Ich bin wie stets beeindruckt von Deiner Fähigkeit, Deine Gefühle und Erfahrungen in Worte zu fassen … und weiter zu geben.
Mein Leben wurde mit 4 Jahren total durch den Tod meiner Mutter erschüttert. Damals hat man es mir als Reise in den Himmel verklickert und — dass sie irgendwann einmal wieder kommt. Das führte in ein Desaster.
Tiefe Gefühle und Mitgefühl sind mir seitdem unbewuβt sehr vertraut und ich fühle mich unter ihnen heimisch.. Heute geht es mir oft genau so wie Du es beschreibst, dieses ja zum Tod und nein zum Leben was sich in ein ja für beides herauskristallisiert.
Danke
Danke!
Ich lese schon einige Jahre die texte von Sarah, durch dein Interview ist sie mir jetzt noch ein Stück näher gekommen…
herzlichst
Ulli
Wie schön. Herzlich, I.
Mal wieder ein ehrlich herzliches Dankeschön, dass du solche Interviews führst!
So klug, und dran an dem, was zählt, wow, und jetzt möchte ich eine Schale dunkelroter Kirschen naschen.