Wie sähe die Ordnung der Welt aus, läge ihr eine weibliche Freiheit zugrunde? Diese Frage steht im Zentrum der feministischen Arbeit von Antje Schrupp. Die in Frankfurt am Main lebende Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Bloggerin zählt sich selbst zum sogenannten Differenzfeminismus. Diese Strömung geht von einer Verschiedenheit der Geschlechter aus und ist mir darum immer ein wenig verdächtig. Dabei geht das Differenzdenken nicht zwingend mit klaren Vorstellungen und festen Zuordnungen von Männlichkeit und Weiblichkeit einher. Im Gegenteil: Antje Schrupp will die Vielfalt weiblicher Perspektiven in Politik und Gesellschaft sichtbar und wirksam(er) machen.
In heutigen Montagsinterview erzählt sie von ihrem Weg zum und ihrem Verständnis von Feminismus. Außerdem sprechen wir über das Thema »Solidarität unter Frauen« und die aktuellen Entwicklungen, auf die sie durchaus optimistisch blickt.
1.000 Dank, liebe Frau Schrupp, für das so interessante wie erhellende Gespräch.
Kurz zu Ihnen: Wer ist Antje Schrupp? Was machen Sie? Was macht Sie aus? Und haben Sie zum Feminismus gefunden bzw. der Feminismus zu Ihnen?
Ich bin Politikwissenschaftlerin und Journalistin, 1964 geboren, und lebe in Frankfurt am Main. Ich arbeite als Redakteurin und als freie Publizistin, halte auch oft Vorträge und Workshops. Meine Leidenschaft ist Politik, allerdings nicht im Sinne von Parteipolitik, sondern im eigentlichen Sinn des Wortes zu verstehen: als Sorge um die Polis, die Art und Weise, wie Menschen ihr Zusammenleben organisieren, wie sie Kultur schaffen, Regeln vereinbaren und so weiter.
Als jüngere Frau habe ich mich für Feminismus nicht sonderlich interessiert. Ich dachte, es betrifft mich nicht, weil ich mich nicht diskriminiert fühlte. Vom Feminismus »angesteckt« wurde ich erst 1994. Damals lernte ich bei einer Tagung zufällig die Sprachwissenschaftlerin und Philosophin Chiara Zamboni aus Verona kennen. Sie ist eine der Vordenkerinnen des italienischen Differenzfeminismus. Von ihr lernte ich, dass Feministin zu sein nicht bedeutet, bestimmte Meinungen zu haben oder Programme vertreten zu müssen, sondern frei zu sein, dem eigenen Begehren zu folgen und einen Sinn in der Tatsache zu finden, dass ich eine Frau bin.
Feminismus tritt nicht nur gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung ein. Es geht um eine ganz neue symbolische Ordnung, bei der nicht länger das Männliche die Norm ist. Die weibliche Freiheit bildet den Ausgangspunkt. Das hat mich sofort elektrisiert. Ich habe begonnen, mich mit dem politischen Denken von Frauen auseinanderzusetzen und nach Bausteinen für eine solche neue Ordnung gesucht.
Was ist Feminismus für Sie und was macht ihn aus Ihrer Sicht gut und wichtig?
Für mich ist die weibliche Freiheit, also die Freiheit der Frauen, nichts, was ich verteidige oder rechtfertige. Es ist mein selbstverständlicher, nicht zur Diskussion stehender Ausgangspunkt. Feminismus ist dann gut, wenn er zur Vergrößerung dieser Freiheit beiträgt, was nicht immer der Fall ist. Der Gleichstellungsfeminismus zum Beispiel denkt die weibliche Freiheit oft nicht für sich. Er koppelt sie, wie der Name ja schon sagt, an den Vergleich mit Männern. Manchmal fordert er sogar von Frauen, sich an männliche Normen anzupassen, die als menschliche ausgegeben werden.
Es gibt auch Feministinnen, die ihre eigenen inhaltlichen Ansichten höher stellen als die Freiheit anderer Frauen. Das passiert zum Beispiel in Bezug auf ihre Ansichten zu Themen wie Kopftuch oder Prostitution. Das ist für mich ein ideologischer Feminismus, also einer, der Ideen und nicht konkrete Praktiken und Lebenserfahrungen ins Zentrum stellt.
Feministischer politischer Aktivismus sollte immer zum Ziel haben, die Handlungsmöglichkeiten von Frauen zu erweitern und nicht zu beschränken.
Das gilt in Bezug auf die äußeren Rahmenbedingungen, in denen Frauen leben. Wir brauchen bessere Gesetze und mehr Zugang zu Ressourcen. Das betrifft aber auch die individuellen Möglichkeiten der einzelnen Frauen. Politischer Aktivismus sollte ihr Selbstbewusstsein, ihre Entschlossenheit, ihre Konfliktbereitschaft stärken. Die politische Praxis, die die Italienerinnen dafür vorschlagen ist es, bedeutungsvolle und starke politische Beziehungen zu anderen Frauen zu führen. Nicht zu »den Frauen«, sondern zu bestimmten Frauen, die man mag, bewundert, deren Begehren in eine ähnliche Richtung geht und so weiter. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert.
Sie vertreten einen sogenannten Differenzfeminismus. Laut der Historikerin Kristina Schulz wollen Vertreter*innen dieser Strömung die Geschlechterhierarchien aufheben, während die Gleichheitsfeminist*innen die Geschlechterdifferenzen aufheben wollen.1
Irgendwie ist da natürlich was dran, aber eigentlich halte ich diese Schubladen für problematisch. Da wird ein Graben aufgerissen, der in der Realität oft gar nicht so groß ist. Man schert alle »Gleichheits-« bzw. »Differenzfeministinnen« über einen Kamm, obwohl sie untereinander ganz verschieden sind. Solche Definitionsversuche sind so Floskeln, die man in Geschichtsbücher schreibt, aber ob sie helfen, die Realität zu verstehen? Ich weiß nicht. Ich betrachte Differenzen lieber kontextbezogen: Was unterscheidet mein Denken und meine Ansichten von meinem Gegenüber?
Das ist doch viel interessanter als zu entscheiden, in welche Schublade sie oder nun ich gehören. Wenn ich mich selbst so labele, dann weil in Deutschland über Differenzfeminismus lange Zeit viel Unfug geredet wurde. Die Positionen wurden verzerrt und schlichtweg falsch dargestellt, wie zum Beispiel in Alice Schwarzers Polemik gegen die »Differenzialistinnen«. Aber auch im akademischen Kontext. Das hat sich heute zum Glück verbessert.
Ich mag das Label aber auch deshalb, weil der Feminismus manchmal zu Konformismus neigt. Er schwört alle, die sich so nennen, auf gemeinsame Positionen ein. Das ist für mich aber grundlegend unpolitisch. Im Bereich des Politischen geht immer darum, den Pluralismus der Menschen zu verhandeln.
Feminismus organisiert nicht die Gruppe »der Frauen«, etwa im Sinne einer Interessensvertretung. Im Gegenteil: Feminismus macht den Pluralismus der Frauen sichtbar, indem er sie als politische Akteurinnen ernst nimmt. Er befreit sie also gerade aus dem Status einer »Gruppe«, in den die patriarchale symbolische Ordnung »die Frauen« gesteckt hatte. Kurz gesagt:
Wenn ich von Differenzfeminismus spreche, meine ich die Differenzen der Frauen untereinander, nicht die Differenz zwischen Frauen und Männern oder sonstigen Geschlechtern. Ich meine damit meine persönliche Differenz als Frau. Die beinhaltet, dass ich die Gültigkeit von Normen bestreite, wenn sie ohne Einbeziehung eines weiblichen Begehrens zustande gekommen sind.
Zum Beispiel ist der westliche Freiheitsbegriff für mich kein Maßstab, weil er lange Zeit überhaupt kein Problem damit hatte, die Freiheit von Frauen zu negieren. Oder die anderer Menschen, etwa der Bevölkerungen von kolonialisierten Ländern. Was für eine Freiheit soll das denn sein, die nicht für alle gilt? Da muss doch am Konzept was falsch sein, und das lässt sich auch nicht durch eine nachträgliche »Gleichstellung« dieser ehemals Ausgeschlossenen beheben.
Heute erweist sich die Vorstellung von Freiheit als Autonomie und Unabhängigkeit tatsächlich als auf vielerlei Ebenen dysfunktional. Mir macht das vielleicht weniger Sorgen als vielen Männern oder auch Frauen, die die männliche symbolische Ordnung nicht hinterfragen, weil meine Freiheit sowieso eine andere ist. Das bedeutet nicht, dass ich diesen Verlust westlicher Freiheitswerte nicht für gefährlich und bedrohlich halten würde. Aber die symbolische Differenz, dass diese Werte und auch die daraus entstandenen Institutionen wie Parlamentarismus oder Rechtsstaat ohne Beteiligung und Einwilligung von meinesgleichen zustande gekommen sind, die will ich schon auch in meinem Aktivismus vermitteln. Zumal das meiner Ansicht nach ein wesentlicher Grund für ihre derzeitigen Probleme ist.
Simone de Beauvoir beschreibt in »Das andere Geschlecht«, eine – wie ich finde – so bemerkenswerte wie auch irritierende Tatsache. Immer wieder, heißt es dort, gab es Fälle in der Geschichte der Menschheit, in dem eine gesellschaftliche Mehrheit eine Minderheit unterdrückt hat. Doch diese Minderheit sei eine stets historische (z.B. das Proletariat). Frauen dagegen seien weder eine Minderheit noch eine historische Entität. Es gäbe genauso viele Frauen wie Männer auf dieser Welt – und zwar schon immer. Trotzdem würden sie seit Jahrtausenden von Männern beherrscht.2 Diese Tatsache kann sowohl Ansporn und Ermutigung zur Veränderung sein, aber genauso kann sie verunsichern und entmutigen. Wie blicken Sie auf diese Geschichte und wie erklären Sie sich diesen Umstand?
Simone de Beauvoir führt die Entstehung des Patriarchats ja auf den Unterschied in der Gebärfähigkeit zurück: Frauen seien durch häufige Schwangerschaften, Geburten und die Sorge für Kleinkinder den Männern gegenüber im Nachteil gewesen. Das habe kulturelle Institutionen hervorgebracht, die für die Frauen nachteilig waren. Deshalb hat Beauvoir Frauen auch so vehement aufgefordert, die Mutterrolle und mütterliche Tätigkeiten aufzugeben. Ich glaube auch, dass die Entstehung des Patriarchats viel mit dem (Nicht)-Schwangerwerdenkönnen zu tun hat, denke aber, dass das keine zwangsläufige Entwicklung war.
Es gab und gibt auch andere, etwa matriarchale Kulturen, in denen die Sorge um Kleinkinder und die sozialen Beziehungen zwischen schwanger- und gebärfähigen und unfähigen Menschen nicht herrschaftsförmig organisiert sind. Und selbst in patriarchalen Kulturen existiert ja eine große Bandbreite von Praktiken und Ideen.
Es ist nicht so, dass alle Frauen im Patriarchat total unfrei sind. Als Menschen sind wir prinzipiell frei, unsere Kultur selbst zu gestalten. Keine Biologie zwingt uns dazu, patriarchal zu sein, und auch soziale Normen sind niemals absolut. Freie Frauen gibt es überall und jederzeit.
Ob eine Frau frei ist, zeigt sich nicht daran, ob sie in unterdrückerischen oder in emanzipierten Verhältnissen lebt. Es zeigt sich daran, ob sie die Möglichkeiten, die sie zur Verfügung hat, ausschöpft. Oder ob sie sich mit dem Gegebenen zufriedengibt, aus Angst vor Konflikten oder auch aus Bequemlichkeit. Gerade emanzipierte Gesellschaften verführen Frauen manchmal dazu, sich mit dem Gegebenen zu begnügen, weil es ja im Vergleich zu früher oder zu Anderswo gar nicht so wenig ist. Aber diese Frauen sind dann nicht freier als eine, die sich ihrem gewalttätigen Vater beugt, weil er sie immerhin mit Essen und Obdach versorgt. Sie leben nur in anderen Umständen.
Das Thema Solidarität spielt eine wichtige Rolle im feministischen Diskurs. Immer wieder wird behauptet, Frauen seien zu wenig solidarisch. Statt zueinander zu halten, würden sie sich entweder mit den Männern solidarisieren (siehe z.B. die MeToo-Debatte) oder sich in Machtkämpfen um die Deutungshoheit gegenseitig schwächen (z.B. Feuilleton-Streit zwischen Alice Schwarzer und Judith Butler). Wie bewerten Sie die Situation und welche Bedeutung messen Sie – warum – der Solidarität unter Frauen* bei?
Ich mag den Begriff der Solidarität nicht besonders, weil er oft dazu benutzt wird, um Differenzen unter Frauen zu verschleiern und einen gewissen Konformismus einzufordern. Es ist ein falscher Anspruch, dass Frauen mit anderen Frauen solidarisch sein sollen, nur weil diese auch Frauen sind. Wenn man es sich genau und im Detail anschaut, geht es darum auch gar nicht.
Zum Beispiel kann ich solidarisch mit Beatrix von Storch sein, wenn sich Leute mit ihr nicht inhaltlich auseinandersetzen, sondern sich über ihr Aussehen lustig machen. Aber dann bin ich nicht mit ihr solidarisch, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eine Politikerin ist, die sexistischen Kommentaren ausgesetzt ist. Solidarität einzufordern ist nur sinnvoll, wenn eine bestimmte Gruppe von Frauen mit einer bestimmten anderen Gruppe von Frauen solidarisch sein soll: Sachbearbeiterinnen in einem Unternehmen mit den streikenden Putzfrauen, wohlhabende Frauen mit armen Frauen, weiße Frauen mit schwarzen. Aber Frausein allein genügt nicht.
Ich finde im Übrigen auch nicht, dass es die Position von Frauen schwächt, wenn sie sich öffentlich streiten. Ganz im Gegenteil, das macht Frauen sichtbar, und zwar als aufeinander bezogen und nicht auf Männer. Das ist so ähnlich wie beim Bechdel-Test: Zwei Frauen reden miteinander, und zwar über ihre eigenen Themen. Das funktioniert, egal ob sie derselben Meinung sind oder unterschiedlicher. Es gibt dem Feminismus Profil, wenn sich Feministinnen streiten. Das ist toll.
Die Auseinandersetzung zwischen Schwarzer und Butler/Hark im Feuilleton war nicht deshalb schlecht, weil sie sich gestritten hätten, sondern weil sie sich leider eben nicht wirklich gestritten haben, sondern die jeweilige Gegenposition einfach nur schlechtgemacht. Die Gelegenheit zum weiterführenden Streiten wurde verschenkt, deshalb fand ich die Artikel langweilig. Aber trotzdem hat ja sogar dieser inhaltlich flache Schlagabtausch die Sichtbarkeit feministischer Debatten erhöht und insofern etwas Gutes gehabt.

Nicht nur die liberale Demokratie, auch sämtliche Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte, gar Jahrhunderte, wie Frauen*- und Minderheitenrechte, Geschlechtergleichheit etc. stehen durch das Erstarken rechten Gedankenguts heute massiv unter Druck. Unmittelbar nach der US-Wahl befürchteten viele Frauen* einen historischen Rückschlag (und viele Indizien, wie z.B. die Haltung der US-Regierung gegenüber Abtreibungsgegnern, scheinen dies zu bestätigen). Wie bewerten Sie die aktuellen Entwicklungen und was macht Ihnen Mut und Hoffnung?
Ich sehe es ein bisschen weniger pessimistisch, denn ich glaube, der Rechtsruck ist eine Reaktion darauf, dass diese Bewegungen erfolgreich waren. Wer am Ende sozusagen »gewinnt«, ist noch nicht ausgemacht.
Es wird meiner Meinung nach vor allem davon abhängen, wie sich der männliche links-liberale Mainstream positioniert, ob er sich auf die Seite der Feministinnen oder der Antifeministen schlägt.
Was allerdings in der Tat momentan klar wird ist, dass Frauenrechte und weibliche Freiheit nicht das selbstverständliche Endziel gesellschaftlicher Entwicklungen sind. Diesen Eindruck konnte man im westlichen Diskurs ja eine Weile lang haben, so als ob die »Gleichstellung« quasi nur noch administrativ abgewickelt werden müsse, bis irgendwann der letzte Depp es verstanden hat. Aber so ist es nicht. Es gibt kein naturgemäß »richtiges« Verhältnis der Geschlechter, sondern es ist eine politische Frage, sie muss – und kann – also immer wieder neu verhandelt werden. Eine Rückkehr des Patriarchats auch in derzeit »emanzipierten« Gesellschaften ist meiner Meinung nach eine reale Möglichkeit.
Es gibt weltweit zahlreiche junge Menschen, die sich feministisch engagieren und den Feminismus weiterentwickeln. Wer von ihnen inspiriert Sie besonders und wem würden Sie ganz besonders gerne einmal ausführlich diskutieren?
Ich habe durch meine Arbeit und meinen Aktivismus glücklicherweise oft Gelegenheit, mit Frauen und auch anderen feministischen Menschen jeden Alters zu reden, deshalb fällt es mir jetzt schwer, einzelne Namen zu nennen. Aber zum Beispiel bin ich ein Fan von Stefanie Sargnagel, weil sie weibliche Souveränität quasi zum Gegenstand ihrer Performance als öffentliche Person macht. Ich fand auch gut, wie Ronja von Rönne auf den Versuch des Feuilletons reagiert hat, sie als Antifeministin aufzubauen, und ihre eigenwillige Position zu behalten.
Also mit diesen beiden würde ich gern mal ein Bier trinken. Wobei mir am heutigen »jungen« Feminismus eigentlich gerade so gut gefällt, dass er vielfältig ist und offenbar kein großes Bedürfnis hat, irgendeine Guru-Repräsentantin nach vorne zu stellen. Von daher ist die interessanteste Feministin eigentlich immer die, mit der ich es gerade zu tun habe.
2 Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Seite 14
Beitragsbild © Alice Donovan Rouse on Unsplash
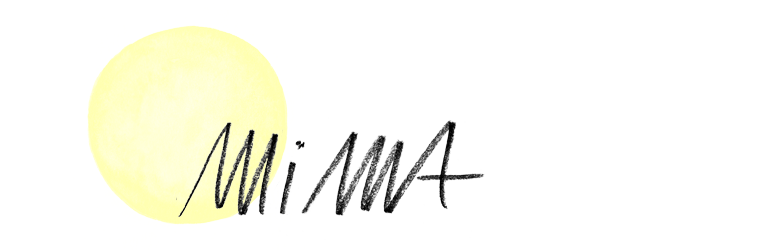






Sehr spannendes Interview – zu gerne hätte ich noch ein paar spannende Literaturempfehlungen von Frau Schrupp abgegrast 😉