In Online-Meetings ist das keine Seltenheit. Bis jede*r die Mute-Funktion deaktiviert hat, ist der Witz längst vorbei. Und das ist nur ein Beispiel dafür, warum virtuelle Zusammenarbeit eine Herausforderung ist.
Was lange Zeit unmöglich schien, war pandemie-bedingt von heute auf morgen machbar: die Umstellung der Arbeitswelt von Präsenzkultur auf Home-Office. Abgesehen von ungelösten neuen Vereinbarkeitsfragen – wie bringt man Home-Office und Home-Schooling/-Betreuung unter einen Hut? – schien der Wandel anfangs gar nicht so groß.
Chatten, Mailen, Online-Meetings, kollaborative Dokumentenbearbeitung – all das war schon vor Corona fester Bestandteil des Arbeitslebens. Nun treffen wir uns halt nicht mehr realen, sondern in virtuellen Meetingräumen und haben sogar für die spontane Flurbegegnung und das Gespräch an der Kaffeemaschine ein digitales Substitut gefunden: die virtuelle Kaffeepausen und Home-Office-Selfies.
Ist der Umzug vom Analog- ins Digitalbüro nicht mehr als ein Ortswechsel?
Ist die Umstellung von analog auf digital also nicht mehr als ein Ortswechsel? So schien es in den ersten Tagen. Doch spätestens nach der ersten Woche im Home-Office war klar, dass das ein Trugschluss ist.
Die Erschöpfung, die ich nach fünf Tagen empfand, war eine andere als die am Ende einer Werkwoche im Büro. Der Grund dafür – so meine These – sind weniger die typischen Begleiterscheinungen der Digitalisierung, wie Informationsüberflutung, permanente Erreichbarkeit, chronisches Multitasking oder störungsbedingter Technikstress (Vgl. TAB-Bericht 2017). Auch das erschöpft natürlich, tritt aber in der „Betriebsstätte“ genauso auf wie daheim.
Der größte Unterschied zwischen Analog- und Digitalbüro – und meines Erachtens die größte Belastung – ist die einseitig reduzierte Präsenz der Welt. Wobei ich Präsenz im ästhetischen Sinne meine: als sinnlich erfahrbares Gegenüber, nicht als verfügbares à la „Präsenzkultur“.

Die einseitige „Sinneskost“ des Digitalbüros macht müde
Im Vergleich zum digitalen Arbeitsplatz ist das klassische Büro ein geradezu sinnesreicher Erfahrungsraum, vor allem wenn es noch „enviromental enriched“ wurde. Im Digitalbüro beschränkt sich meine Sinnesaktivität aufs Sehen und Hören. Ich kann den Kaffeeduft aus der Küche und das Eau de Toilette meines Tischnachbarn nicht riechen, das rastlos wippende Bein meiner Kollegin nicht spüren und auch meinen sechsten, den Gleichgewichtssinn, spricht der digitale Arbeitsort nicht an.
Bei Kindern sind die Folgen einer solch unausgewogenen „Sinneskost“ (Hurrelmann) seit Langem bekannt: Sie beeinträchtigt die Sprachentwicklung, die (Psycho-)Motorik und die Wahrnehmungsfähigkeit (Quelle). Was sie mit Erwachsenen macht, scheint dagegen kaum erforscht.
Meine auf anekdotischer Evidenz basierende These ist, dass wir die fehlenden sinnlichen Qualitäten kurzfristig kognitiv kompensieren und darum am Ende eines Tages im Digitalbüro so viel müder sind als sonst.
Was macht eine sinnlich reduzierte Wahrnehmungswelt auf lange Sicht mit uns?
Was die einseitige Sinneskost der digitalen Arbeitswelt langfristig mit uns macht, ist noch nicht absehbar. Dass sie etwas mit uns macht, davon bin ich überzeugt. Denn ob und wie wir uns in der Welt zurechtzufinden und anderen begegnen, hängt wesentlich davon ab, wie wir uns selbst im Verhältnis zur Welt wahrnehmen.
„Der Mensch ist zur Welt, er kennt sich allein in der Welt.“
Maurice Merleau-Ponty
Dabei spielt die ganzheitliche Wahrnehmung mit allen Sinnen und dem ganzen Leib eine wichtige Rolle. Nehmen wir die Welt und uns selbst in der Welt nur noch mit unseren Augen und Ohren wahr, wird sich dies auf unser Selbst- und Fremderleben und damit auch auf unsere kognitiven Fähigkeiten und handwerklichen Fertigkeiten auswirken.

Die blinden Flecken in unserem Denken könnten sich vermehren
Für die Philosophin Chiara Zamboni ist die ganzheitliche sinnliche Erfahrung anderer Menschen konstitutiv für gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklungen. Ihre These, die sie am Beispiel des Feminismus exploriert, ist, dass erst ein „Denken in Präsenz“ volle Wirkungsmacht entfaltet:
Natürlich kann man Bücher und Artikel lesen, die vom weiblichen Denken handeln, aber man stellt doch fest, dass sie nur dann ein wahrer Maßstab für das politische Handeln werden, wenn man persönlich Frauen kennt, […]. Dann wandeln sich diese Texte, die ein Beitrag zur Kultur sind, in Orientierungen für eine lebendige Aktion.
Chiara Zamboni in: Denken in Präsenz | übersetzt von Antje Schrupp
Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp meint in Rekurs auf Zambonis Präsenztheorie, „dass neue Ideen oder auch neuer Sinn … nur entstehen können, wenn Sprache zirkuliert, wenn Worte wie Spielbälle hin und her fliegen können, Sätze vorläufig ausprobiert werden.“ (Quelle)
Das kann im Umkehrschluss nicht heißen, dass wir ohne die leibliche Präsenz unserer Mitmenschen nichts Neues bzw. Sinn hervorbringen könnten und unser Denken wirkungslos bliebe. Dagegen spricht die Wirkung von Goethes Werther ebenso wie jede*r Nerd. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass die beschränkte Sinnlichkeit die blinden Flecken in unserem Denken vermehrt, wenn wir nicht jede*r für sich mit großer Aufmerksamkeit dagegen angehen – was wiederum sehr müde macht. Oder aber wir sorgen alle zusammen für mehr sinnliche Vielfalt in der digitalen Arbeitswelt. Reichlich Inspiration bietet dafür die Kunst.

Fotos: Gnider Tam, Creedi Zhong, aj_aaaab (Unsplash)
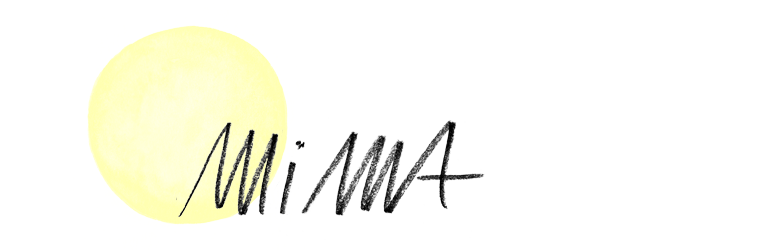


besten dank für diesen artikel!
Danke für diesen Input!
Liebst,
Jule*