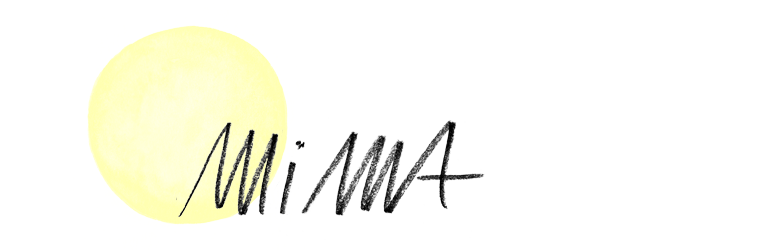Interview mit Dr. Katharina Wrohlich (DIW)
Am 16. April veröffentlichen 12 Ökonom*innen des DIW ihre Forderung für ein Corona-Elterngeld. Es müssten, so die Forscher*innen aus den Abteilungen Bildung und Familie, Staat, Gender Economics und SOEP, auch die Probleme der erwerbstätigen Eltern entschieden angegangen und sie mit einem Corona-Elterngeld entlastet werden.
Wie die Idee von der Politik aufgenommen wird, das Corona-Elterngeld konkret ausgestaltet werden sollte und warum Diversity gerade auch in der Wissenschaft wichtig ist, darüber habe ich mit Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics, gesprochen.
Vielen Dank für das Gespräch, Katharina!
Du und deine Kolleg*innen am DIW fordern ein Corona-Elterngeld, um erwerbstätige Eltern in der absehbar anhaltenden Krise zu entlasten. Wie könnte das Corona-Elterngeld konkret gestaltet werden?
Unsere Idee ist eine Corona-Elternzeit und ein Corona-Elterngeld für Familien mit Kindern bis zu 12 Jahren. Erwerbstätige Alleinerziehende sowie Familien, in denen beide Eltern gemeinsam, also in Summe, mehr als 40 Stunden arbeiten, sollten jeweils eine Reduzierung der individuellen Arbeitszeit zur Kinderbetreuung beim Arbeitgeber beantragen können und dafür einen staatlichen Einkommensersatz erhalten. Um Geschlechterunterschiede bei der Erwerbs- und Sorgearbeit nicht zu verschärfen, sollte die Leistung bei Paaren an die Bedingung geknüpft werden, dass beide Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren.

Was hat euch zu diesem Schritt veranlasst?
Ausgangspunkt für unsere Überlegungen war die derzeit fehlende Perspektive für Eltern mit betreuungspflichtigen Kindern aufgrund der zeitlich nicht eingegrenzten Verlängerung der Schul- und Kitaschließungen.
Nach Berechnungen des statistischen Bundesamtes gibt es in Deutschland etwa 4,2 Mio Familien mit Kindern bis zu zwölf Jahren, bei denen beide oder alleinerziehende Elternteile erwerbstätig sind. Für die meisten dieser Familien ist das täglich genutzte System zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Corona-Maßnahmen ausgefallen. Die Politik sollte endlich anerkennen, dass diese Familien nicht über Monate ihre Erwerbstätigkeit in gewohntem Umfang aufrechterhalten können, wenn sie „nebenbei“ Kinder betreuen und Home-Schooling organisieren müssen. Dieses „Durchwurschteln“ werden viele so nicht länger durchhalten können.
Wie sind die bisherigen Reaktionen der Politik auf eure Forderung?
Die Grünen haben ein ähnliches Konzept wie das Corona-Elterngeld vorgeschlagen, um Familien bei der Vereinbarkeit der Betreuungsarbeit und der Erwerbstätigkeit zu entlasten. Allerdings fehlt im Konzept der Grünen die strikte Bedingung, dass bei Paaren beide Elternteile die Arbeitszeitreduktion beantragen müssen. Abgesehen davon habe ich noch nicht mitbekommen, dass die Idee von der Politik aufgegriffen wurde.
Das Corona-Elterngeld muss an die Bedingung geknüpft werden, dass beide Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren, da sonst die Gefahr besteht, dass in erster Linie Mütter eine Arbeitszeitreduktion beantragen und alle daraus folgenden beruflichen Nachteile tragen.
Dr. Katharina Wrohlich
In Sachen Gleichberechtigung hatte Deutschland auch vor Corona Entwicklungspotenzial (siehe z.B. BMFSFJ-Studie „Mitten im Leben“). Die gleichstellungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Doris Achelwilm, befürchtet auf dem Gebiet nun weitere Rückschritte (taz). Welche krisenbedingten Effekte auf die Gleichberechtigung beobachtet ihr? Und (wie) könnte ein Corona-Elterngeld geschlechterspezifische Ungleichheiten vermeiden?
Es ist noch zu früh um zu sagen, weile Effekte die COVID-19 Pandemie auf die Geschlechterungleichheiten tatsächlich hat und haben wird. Es gibt viel anekdotische Evidenz dazu und teilweise Daten nicht-repräsentativer Umfragen, die darauf hindeuten, dass Frauen in dieser stärker belastet sind als Männer, weil sie die Hauptlast der zusätzlichen Sorgearbeit aufgrund der Kita- und Schulschließungen zu tragen haben. Wie sich die Situation aber wirklich auswirkt, werden wir erst sehen, wenn wir repräsentative Daten dazu ausgewertet haben, das wird vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein.
Um jedenfalls die – unabhängig von COVID-19 – bestehenden Geschlechterunterschiede bei der Erwerbs- und Sorgearbeit nicht noch weiter zu vergrößern, sollte ein Corona-Elterngeld bei Paaren an die Bedingung geknüpft werden, dass beide Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren. (Ausnahmen könnte es beispielsweise geben, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf, beispielsweise im medizinischen Bereich, arbeitet.) Das ist ein sehr wichtiger Baustein dieser Leistung, da sonst die Gefahr besteht, dass in erster Linie Mütter eine Arbeitszeitreduktion beantragen um die Betreuung der Kinder zu übernehmen, und sie dann auch alle daraus folgenden beruflichen Nachteile tragen.

Die Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina werden auch innerhalb der wissenschaftlichen Community für die fehlende Perspektive von Familien und Frauen* sowie für die fehlende Repräsentativität des Gremiums kritisiert. Für Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin spiegelt diese Einseitigkeit wider, „was die Ad hoc-Empfehlung ausspart.“ (Tagesspiegel). Wie siehst du das?
Die Zusammensetzung der Leopoldina-Runde und ihre Ergebnisse ist als Beispiel für die Auswirkungen fehlender Diversity in Gremien extrem plakativ. Der Beitrag von Jutta Allmendinger im Tagespiegel hat das sehr treffend kommentiert. In der Wissenschaft werden – ebenso wie in allen anderen Bereichen – Entscheidungen getroffen, und diese Entscheidungen werden von persönlichen Merkmalen, von der persönlichen Lebenswirklichkeit der handelnden Personen beeinflusst. Zu allererst steht die Entscheidung an, was überhaupt geforscht werden soll.
Was mich persönlich im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung von COVID-19 beunruhigt ist, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, ob Kinder überhaupt maßgeblich zur Verbreitung des Virus beitragen. Hier bräuchte es dringend mehr Forschung! Schul- und Kita-Schließungen sind eine Maßnahme, die für eine große Gruppe von Menschen extreme Kosten und Belastungen verursacht, und wir wissen nicht, ob die Maßnahme im Fall von COVID-19 überhaupt wirksam ist.
Um Eltern in der aktuellen Krise zu entlasten, wäre ein Corona-Elterngeld ein wichtiger Schritt, denn es nimmt existenzielle Ängste. Gegen den Bewegungsmangel oder fehlende Kontakte hilft es jedoch nicht. Welche Möglichkeiten und Maßnahmen sieht ihr hier?
Wir haben in unserer Pressemitteilung zwei Ziele formuliert, einerseits eine Maßnahme, die erwerbstätige Eltern entlastet. Andererseits haben Kitas und Schulen neben der Betreuungsfunktion ja auch ganz wesentliche Bildungs- und Sozialisationsaufgaben! Daher schreiben wir auch in unserer Pressemitteilung, dass dringend Konzepte erarbeitet werden müssen, die eine Teil-Öffnung der Kitas bei maximaler Infektionsvorbeugung ermöglichen. Denkbar wäre beispielsweise die tageweise Betreuung in kleinen Gruppen von Kindern. Da Kitas ein zentraler Ort frühkindlicher Bildung sind, sollte der dosierte und schrittweise Besuch der Kita explizit nicht an die Erwerbstätigkeit der Eltern gekoppelt sein.

Fotos: L. Jansone