Reisen bildet, heißt es. Seit unserem »Roadtrip« durch Georgien weiß ich einmal mehr, wie Reisen bildet. Mitunter recht radikal. Mark Twain brachte es auf den Punkt:
»Reisen ist tödlich für Vorurteile.«
Nicht nur mein Begriff von »Landstraße« hat eine – im wortwörtlichen Sinne – neue Dimension erfahren, auch mein Möglichkeitssinn hat einen Quantensprung gemacht. Ganz gleich ob Wohnen, Essen oder Autofahren, Gastfreundschaft oder Chorsingen. All das geht auch ganz anders, als ich es kenne. Eine Binsenweisheit vielleicht. Ich musste für diese Erkenntnis 2.000 Kilometer durch das kleine Land im Kaukasus gerüttelt und geschüttelt werden. Konservengleich in einem Minibus mit sechs anderen Mitreisenden und Blasen an den Händen – vom Umklammern des Haltegriffs, damit es mich beim nächsten Schlagloch nicht aus den Angeln hob. Aber der Reihe nach.
Tarchuna (georgisch ტარხუნა, dt.: Estragon) heißt die grüngefärbte georgische »Limonade«, die 1887 von Mitrophane Laghidse erfunden wurde. Dazu hatte der Tifliser Apotheker Estragonsirup mit kohlensäurehaltiges Wasser gemischt. 1981 begann in der Sowjetunion die industrielle Massenproduktion von Tarchuna, was das Getränk über Georgien hinaus populär machte. Quelle: Wikipedia
Anders als erwartet wurde uns sehr wohl ein Snack serviert. Neben einem nudelartigen Gericht befanden sich Weißbrot, Käse, Tomaten und Gurke in der schlichten Menübox der Georgian Airways. Noch wussten wir nicht, das uns diese Kombination fortan täglich gereicht werden würde – und zwar morgens, mittags und abends. Ebensowenig wussten wir, dass das grüne Getränk, das der Steward uns auf Limonadenwunsch überreichte, eine Art georgisches Nationalgetränk war und das, was wir schmeckten, Estragon.
Später lernten wir noch allerhand andere Limonaden-Variationen kennen: von Zitrone über Birne, Traube und Berberitze bis hin zu Sahne-Creme, was überraschend gut schmeckte (es soll auch frischgezapfte Schoko-Limo geben).
Die ersten zweieinhalb Tage unserer Reise schweiften wir durch Tblissi, versuchten seiner »psychischen Klimazonen« habhaft zu werden, was nur bedingt gelang. Wir mussten uns erst einmal als Gruppe finden. Die Widersprüchlichkeit und noch mehr die Baufälligkeit der Stadt versetzte mich immer wieder in Erstaunen. Hierzulande wäre die Hälfte der Häuser wegen Einsturzgefahr gesperrt.
Mein Verhältnis zur georgischen Hauptstadt blieb bis zuletzt gespalten, woran auch der Verkehr seinen Anteil hatte, der so überbordend war wie die Speisen beim Supra (Festessen). Die Luft war entsprechend und der Lärm bisweilen ohrenbetäubend. Als Ort, an dem ich leben könnte, begegnete mir Tblissi erst am vorletzten Tag unserer Reise, während meines frühmorgendlichen Spaziergangs zum Mtazminda (georgisch მთაწმინდა, dt. heiliger Berg).
O, Mtazminda, heiliger Berg, deine Gegenden Die mich anfallen, die bestürzenden, wüsten, öden Wie schön sie sind, wenn der Himmelstau auf sie fällt Wenn am milden Abend blasse Strahlen nur bleiben! aus: »Abenddämmerung auf dem Mtaziminda« von Nikolos Barataschwili
Geweckt wurde ich von den Pinienzapfen, die in unregelmäßigen Abständen auf das Blechdach unter unserem Fenster fielen. Der Berg lag noch im Nebel als ich zum Frühstücksraum schlich, vorbei an der spaltbreit geöffneten Bürotür, hinter der der Hotelangestellte schlief. Mitten in der Nacht hatte ich ihn um eine Flasche Wasser bitten müssen (das Leitungswasser ist nicht trinkbar). Ich hoffte, ihn mit dem Rauschen des Wasserkochers nicht erneut zu wecken. Wenn ich es doch tat, so war er zuvorkommend genug, mich meinen Instantkaffee ungestört trinken zu lassen.
Zu dieser frühen Morgenstunde war selbst die sechsspurige Rustaweli Avenue noch ruhig. Das scheußlich-schöne Biltmore Hotel glitzerte in der Morgensonne. Ich ließ es rechts liegen und mich durch Vere, Mtazminda und Sololaki treiben, die drei historischen Viertel, hinauf zum »heiligen Berg« und wieder hinunter. Die Stadt erwachte langsam, und während ich durch die noch stillen Straßen strich, nahm ich endlich ihre Atmosphären wahr, bekam eine Ahnung, dass und wie es sich hier leben ließe (seither möchte ich wiederkommen).
Georgien ist heute ein sehr widersprüchliches Land, zerrissen zwischen Aufbrüchen ins Ungewisse und sehr alten Traditionen. Fast alle Georgier sind bei Facebook, aber in den Bergen des Großen Kaukasus gibt es noch pagane Heiligtümer, an denen den alten Naturgottheiten Tieropfer dargebracht werden – seit Jahrhunderten bestehen diese Bräuche neben dem orthodoxen Christentum. Lyrik aus Georgien »Fortgegangen bin ich ohne Rückfahrkarte« von Norbert Hummelt, in: deutschlandfunkkultur | 31.08.2018

Etappe 1: Tuscheti
»Weißt du, dass der Abano Pass zu den gefährlichsten Straßen der Welt zählt?«, fragte meine Reisebegleiterin am Abend vor der Abfahrt. Ich wusste es nicht, und war mir in diesem Moment auch ziemlich sicher, dass ich es nicht wissen wollte (»Ignorance is Bliss«). Was Johannes Freybler über seine Reise nach Tuscheti schrieb, fand ich alles andere als beruhigend, schlief aber dennoch irgendwann ein. Anders der Mann. Der hatte des nachts festgestellt, dass wir es versäumt hatten, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Ein Versäumnis, das nicht mehr korrigieren war (alle Versuche blieben vergeblich) – und der erste Crash-Kurs in Sachen Gottvertrauen.
Vor der Hoteltür warteten zwei Geländewagen samt Fahrer. Nur 20 Kilometer hinter Tblissi wurde M. (9 Jahre) speiübel. Wir kamen gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Es sollte bei diesem einen Mal bleiben. Sie nahm die Fahrerei fortan mit überraschender Gelassenheit, manchmal gar Freude hin. Ich dagegen wurde immer wieder vom blanken Entsetzen gepackt, wenn wir auf zweispuriger Straße dreispurig überholten, sich unmittelbar neben mir tausend Meter tiefe Schluchten auftaten oder wir uns im Affenzahn die Serpentinen hochschraubten, um mit quietschenden Reifen gerade noch rechtzeitig vor einer Kuh zum Stehen zu kommen (angeblich stehen die Wiederkäuer gerne mitten auf der Fahrbahn, weil der Luftzug der Autos die Fliegen vertreibt).
Es gibt vier Möglichkeiten nach Tusheti zu kommen: mit dem Hubschrauber, zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Auto über den Abano Pass, der jedoch nur von Ende Mai/Mitte Juni bis Mitte Oktober befahrbar ist.
»Hier Zivilisation Ende«, radebrechte unser Fahrer, als wir vor einem Eckladen zum Halten kamen. 70 Kilometer bis Omalo stand auf dem Schild daneben. »Ist ja gar nicht mehr weit«, freute ich mich. Er grinste mich an: »Minimum sechs Stunden, vielleicht sieben.« Er sollte recht behalten. Wir deckten uns mit Mineralwasser, Benzin und Keksen ein. Nach rund 10 Kilometern wandelte sich unsere Straße in einen unbefestigten Schotterweg: der Aufstieg zum Abano Pass bis in 3.000 Meter Höhe begann. Bei der nächsten Pinkelpause holten die Männer einen Champagner hervor. Der erste Toast ging auf all jene, die die Passfahrt nicht überlebt hatten – Gaumardschoss! Ich wünschte mich weit, weit weg.
Je höher wir fuhren desto dichter wurde der Nebel, und mir schwante, dass er ein Segen war. So konnte ich den Abhang, der sich unmittelbar neben mir auftat, nur ahnen (hätte ich ihn gesehen, man hätte mich mit dem Hubschrauber aus Tuscheti ausfliegen müssen).
Ich habe noch keinen passenden Begriff für den Zustand, der sich nach sehr großer, sehr langer Anspannung einstellt. Eine Mischung aus Erleichterung und Erschöpfung, angesiedelt irgendwo zwischen hysterischem Lachen und Heulen. Es wäre sicher gut gewesen, mich diesen Gefühlen mit Inbrunst hinzugeben, doch die wilde Schönheit Tuschetis forderte meine volle Aufmerksamkeit.
»Von der Hauptstadt Tbilissi sind es nur einhundert Kilometer, aber gefühlt liegt dieses Tuschetien hinter den sieben Bergen und einigen mehr.« Bjorn Erik Sass: Bei den letzten Cowboys, in: DIE ZEIT 11/2010
Drei Tage und zwei Nächte blieben wir hinter den mehr als sieben Bergen, was unser längster Aufenthalt an einem Ort sein sollte (nur in Batumi blieben wir noch einmal für zwei Nächte – gegen unseren Wunsch, aber das ist eine andere Geschichte). Unter kamen wir in der Pension Buchurtha in Omalo (Unteres Dorf), die uns mit einer Mischung aus Schlichtheit und Herzlichkeit für sich gewann. Ich mochte das Abendessen auf der offenen Veranda und das Frühstück vor den Wandteppichen im Holzverschlag, das sich wesentlich nur durch die Konfitüren und den fehlenden Alkohol vom abendlichen Speiseplan unterschied.
Sollte es ein nächstes Mal für mich geben, so würde ich mir mindestens eine Woche für dieses besondere Fleckchen Erde aufbringen. Tuscheti ist wunderschön. Die Schweizer*innen in meiner Reisegruppe erinnerte es an Graubünden, mit dem Unterschied, dass das großkaukasische Hochgebirge nicht im Ansatz erschlossen ist. Alles ist hand- und selbstgemacht (D.I.Y. at it’s best): angefangen bei den Straßen über die Pensionen und Cafés bis hin zu den »Fast Food«- und Souvenir-Läden mit traditionellen Handarbeiten aus Schafwolle und Filz.
Mit dem Geländewagen bretterten wir durch die unermessliche Weite und Schönheit, und hätte ich nicht so viel mit meiner Höhenangst zu tun gehabt, wäre ich aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen. In Dartlo, das für manch eine*n das schönste Dorf Tuschetis ist, tranken wir türkischen Kaffee zwischen jahrtausendealten Schiefermauern mit Blick in die Ebene; am anderen Ufer des Pirikita-Alazani trabte eine Reisegruppe zu Pferde (die kaukasischen Karbadiner sind friedliebend und sicher auf steinig-steilem Gelände). Dann ging es weiter Richtung Nordwesten. Die Regenfälle der vergangenen Tage hatten den Fluss stark ansteigen lassen; die Durchfahrt war selbst unseren Fahrern zu gefährlich. So machten wir eine kurze Rast, hielten die Zehen ins kalte Wasser, staunten über die Geschicklichkeit der Schafe am steilen Hang und die Eleganz des Reiters beim Durchqueren der Strömung.
Tschetschenien war von hier nur einen Steinwurf entfernt und die Willkür und Fragilität nationaler Grenzen körperlich spürbar.
Der Tag endete mit einem Supra (Festessen). Noch staunte ich über die üppige Tafel, die über und über gedeckt war mit Speisen. Erst später begriff ich, dass der Überfluss zur Supra gehört wie der Tamada zum Trinken und mein Nachhaltigkeits-Über-Ich (die Hälfte des Essens blieb immer übrig) hier fehl am Platz war. Auch Weißwein und Tschatscha (georgischer Tresterbrand) flossen in Mengen. Beim Gedanken an die Rückfahrt nahm ich lieber noch einen kräftigen Schluck.
Am frühen Morgen des Rückreisetags – die anderen schliefen noch – machte ich mich zur Burgruine im oberen Dorf von Omalo auf (diese frühmorgendlichen Alleingänge sollten mein Rettungsanker auf dieser rast- und ruhelosen Reise werden). Dass die uralten Wehrtürme noch bzw. wieder stehen, ist dem niederländischen Staat zu verdanken, der wie viele andere EU-Staaten und internationale Organisationen für die Region, Geld bereitstellte. Ein atemberaubender Blick wurde mir zuteil und die nächste schocktherapeutische Übung in Sachen Höhenangst.

Hoch sollte es bleiben an diesem letzten Tag in Tuscheti. Bevor wir die Rückfahrt über den Abono Pass bei strahlend blauem Himmel und bester Sicht antraten (ich sag nur Hubschrauber), machten wir noch eine Stippvisite nach Diklo, Tschesho und Bochorna, den drei sehr abgelegenen und entsprechend abenteuerlich zu erreichenden Bergdörfern.
Bochorna liegt auf 2.345 Meter Höhe und ist damit das höchste bewohnte Dorf Georgiens und Europas, wobei es den Zusatz »bewohnt« insbesondere einem bald achtzigjährigen Arzt verdankt, der hier (anders als die meisten Bewohner*innen Tuschetis) auch im Winter lebt und dafür berühmt ist, ohne Narkose zu operieren (Quelle). Diklo war das improvisierteste Dorf, das ich bisher gesehen hatte; vor der Kulisse des Gebirgsmassiv entfaltete es eine frappierende Schönheit (die rote Zora kam mir spontan in den Sinn).
In Tschesho, das sich – so mein Eindruck – gerade als alternativtouristischer Mikro-Hotspot neu erfindet, befand sich die einzige Kirche Tuschetis. Mitten auf einem grünen Hügel oberhalb des Dorfs, im Hintergrund die paganen Heiligtümer. Unsere Tücher kamen hier endlich zum Einsatz; fortan hatten wir sie griffbereit im Handgepäck, denn nachdem wir Tuscheti verlassen hatten, sollten wir mindestens eine heilige Stätte pro Tag besuchen (und Frauen erhalten im patriachal geprägten Georgien, wenn überhaupt, dann nur mit Kopf-, Schulter- und Beinbedeckung Zutritt zu den orthodoxen Klöstern und Kirchen. Den paganen Heiligtümern dürfen sie sich nicht einmal nähern).
Unsere nächste Etappe führte uns nach Gurdschaani, in die Wüste Dawit Garedscha und weiter bis Batumi, wo wir nicht sein wollten. Doch davon mehr beim nächsten Mal.
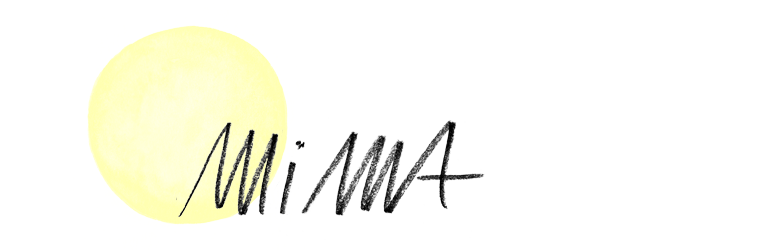






















































Ich bin überwältigt. In alle Richtungen.
Was für eine aufregende Reise – danke fürs Mitnehmen (also hier zumindest) freue mich schon auf weitere Fotos und Berichte. Ganz liebe Grüße 🙂
Oh, bitte, schnell mehr. So spannend und die Fotos wunderschön. <3