Sie ist (für mich) der Punk unter den Elternblogger*innen. Ich kenne keine*n andere*n, der/die die Dilemmata und Abgründe, die Leiden und Lügen des Elternseins so schnodderig-schön und klar zur Sprache bringt wie Liz Birk-Stefanovic. Seit Oktober 2014 erzählt die freie Texterin mit leidenschaftlicher Aufrichtigkeit und ebensolcher Unregelmäßigkeit auf »Kiddo The Kid« aus ihrem Leben mit Kind und Mann in der Hauptstadt, in der sie bis heute nicht heimisch wurde. Und dort kann man so wunderbare weise Sätze lesen wie diesen:
»Als Eltern ist es unsere Aufgabe, unsere Kinder als Menschen anzunehmen. Wir müssen ihnen eigene Perspektiven zugestehen, eigene Temperamente, eigene Wünsche, Meinungen, Gefühle. Dieses Aushalten des Fremden im Kind ist nicht leicht.«
Daneben schreibt sie auf »Schattentiere« über das, was sie ihr Verrücktsein nennt: das Leben als schlampig aufs Original gelegte Kopie ihrer selbst. Was genau sie damit meint und wie es dazu kam – auch darum geht es im heutigen Montagsinterview, mit dem ich allen ein gelungenen Start in die KW 10 wünsche und dir, liebe Liz, 1.000 Dank sage!

Du lebst mit Mann und Kind in Berlin und »wurstelt dich so durch«, heißt es auf deinem Blog. Was bedeutet »durchwursteln«?
Durchwursteln – machen das nicht die meisten? Zumindest wünsche ich mir, dass andere auch mal planlos sind. Ich erschrecke immer ein bisschen, wenn Menschen ein Ziel nach dem anderen abhaken. Und bin darauf auch zugegebenermaßen neidisch, weil ich selbst dauernd das Gefühl habe, es ist schon Arbeit genug, den Kopf über Wasser zu halten. Vielleicht gibt es da einen Trick, den ich nicht kenne. Dann möchte ich jetzt gern, dass mir den eine*r verrät.
Berlin ist mein Denkmal des Durchwurstelns: Mich hat vor über 15 Jahren die Liebe hierher geschleppt. Es war Abneigung auf den ersten Blick. Ich gab mir damals so 1-2 Jahre, saß mental immer auf gepackten Koffern. Das Gefühl der Zwischenstation hält sich immer noch, denn aus irgendwelchen seltsamen Gründen habe ich nie den Absprung geschafft. Berlin und ich, wir sind uns bis heute nicht nah gekommen. Mein Mann wiederum lebt hier sehr gern, das verkompliziert die Sache natürlich.
Mittlerweile ist der Gedanke an einen Abschied aber auch nicht mehr so leicht, denn ich habe Freund*innen und eine gut etablierte Selbständigkeit in diesem Berlin. Meine Tochter ist hier geboren und schlägt gerade Wurzeln. Bis ich rausgefunden habe, wohin die Reise geht, ist Durchwursteln ganz in Ordnung.

Für mich bist du der Punk* unter den Elterblogger*innen. Wie und wo verortest du dich selbst im Universum der Blogosphäre und wie geht es dir dort?
Danke, das ist ein fabelhaftes Kompliment. Allerdings bin ich ein seeehr introvertierter Punk: Ich kann nicht gut reden, Menschen sind mir oft unheimlich und ich verstehe diese feine Morsesprache des sozialen Lebens nicht. Ich drücke mich lieber schriftlich aus. Mit dem Bloggen begonnen habe ich, als meine Tochter noch ein Baby war. Einfach, weil mir das Schreiben ein Bedürfnis ist und all das Neue irgendwohin musste.
Nach einem halben Jahr »Kiddo The Kid« war ich dann auf der ersten Blogfamilia und habe tolle, freundliche, lustige Menschen getroffen. Das hat mich sehr bereichert. Ich wäre gern noch besser vernetzt, aber das ist ein irrer Stress: Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie Leute es schaffen, zu twittern. Jeden Tag! Mehrmals! Ich hab das versucht, aber es macht mich wahnsinnig. Instagram find ich okay, dort treffe ich dann auch die anderen Elternblogger*innen.
Ich weiß, dass ich mich mit meinem Blog in einer Nische niedergelassen haben, kann sie aber nicht beschreiben. Mir selbst kommt es vor, als würde ich mich dauernd öffentlich beschweren. Meine Leser*innen scheinen mir das nicht nachzutragen, denn ich bekomme sehr viele freundliche Kommentare und Mails. Es hat sich da eine offene und wertschätzende Atmosphäre entwickelt, dafür bin ich unheimlich dankbar. Dass ich doch bitte regelmäßiger bloggen soll, wird mir manchmal gesagt, und ich wünschte wirklich, ich könnte das. Ich hab auch mal versucht, aus Prinzip mehr zu schreiben, aber die Texte wurden alle scheiße. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann macht das für mich keinen Sinn.
Dass der Blog seinen Ton nicht verliert, ist mir unheimlich wichtig. Auch bei zwei Beiträgen im Jahr. Deshalb mache ich auch keine Kooperationen oder Produkttests oder sowas. Ich brauche diese Konsistenz im Erzählen, und ich will, dass es MEIN Erzählen ist. Beruflich schreibe ich für andere Menschen – und was ich für mich schreibe, das verkaufe ich schlichtweg nicht.
Manchmal habe ich auch schon dran gedacht, »Kiddo The Kid« zu schließen. Weil ehrlich, braucht man einen Blog für ein oder zwei Texte in zwölf Monaten? Aber doch, ich brauche das. Und wenn ich dann was schreibe, dann ist es so aufrichtig, wie ich nur kann.
Die Blogosphäre ist ein wichtiges Bezugssystem zur Vermessung des (elterlichen) Selbst – und dabei nicht immer eines, das eine*n stärkt, wie du in exemplarisch in deinem Text »Elternprekariat« beschreibst. Was braucht es, um in dieser (Schein-)Welt gut zurechtzukommen?
Also, wenn ich das mal wüsste! Ich kann Dir aber sagen, wie ich das für mich persönlich halte: Ich wähle sehr bewusst aus, wen und was ich lese. In meinem Feedreader und auf Instagram habe ich Kahlschlag betrieben. Ich finde es toll und inspirierend, wenn Menschen sich gut kleiden und einrichten können, aber ich muss dazu auch Authentizität spüren, sonst langweilt mich das (und verunsichert mich gleichzeitig. Geht das überhaupt? Ich glaube schon).
Und mit Texten ist das nicht anders. Ich will lesen, wie es anderen Eltern geht. Womit sie kämpfen, was sie lieben, was sie fürchten. Ich will lesen, dass andere ihre Kinder auch manchmal so schrecklich finden, oder dass sie mit ihrer Elternschaft hadern. Oder neidisch sind oder sentimental oder gluckig. Kurz gesagt: Ich will von echten Menschen lesen. Oh Gott, das klingt jetzt, als wäre ich total spaßbefreit. Echte Menschen heißt natürlich auch: Glückliche echte Menschen.

Es gibt immer wieder Aktionen, die zu mehr »Ehrlichkeit« und »Authentizität« in den sozialen Medien aufrufen. Unter dem Hashtag #jetztmalehrlich wurde auf Instagram zum Beispiel jüngst dazu eingeladen, das »echte Leben« zu zeigen. Was hältst du von solchen Aktionen?
Hm ja, was halte ich von solche Aktionen – ich bin zwiespältig. Einerseits will ich ja immer Authentizität, andererseits schau ich mir echt nicht gern unordentliche Wohnungen auf Instagram an. Dann lieber ungeschminkte Gesichter und reale Körper und ehrliche Bildunterschriften. Ich möchte Menschen sehen, keine Möbel. Dass bei jemanden das Geschirr in der Spüle schimmelt, sagt mir wenig über das »echte Leben« anderer Leute.
Andererseits ist es gerade auf Instagram auch irre schwer, so ein Real-Life-Movement zu starten. Die Plattform gibt das in ihrer Ausrichtung kaum her. Und natürlich wollen Menschen ästhetische Bilder sehen und posten. Da nehme ich mich nicht aus. Die Gratwanderung zwischen authentisch und netztauglich ist sehr heikel.
Es ist nicht die Aufgabe der Kinder, uns Eltern glücklich zu machen. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, sie glücklich zu machen, schreibst du in einem deiner Texte (Quelle) und mir wird bei dem Gedanken an diese Herkulesaufgabe ein wenig schwindelig. Wie lässt sie sich deines Erachtens stemmen, ohne am permanenten Gefühl des Versagens zu verzagen?
Stimmt, das habe ich gesagt. Jetzt fällt mir meine Verknappung aber hart auf die Füße. Also, ich glaube eigentlich nicht, dass es gelingen kann, einen anderen Menschen glücklich zu machen. Glück ist in meinen Augen ein Impuls, der von innen kommt. Und ein Dauerzustand sowieso nicht.
Wenn ich davon rede, dass unsere Kinder nicht dazu da sind, uns glücklich zu machen, sondern eher umgekehrt, dann meine ich: Es ist unsere Aufgabe, sie als Menschen anzunehmen. Wir müssen das immer wieder versuchen, so gut wir eben können. Ihnen eigene Perspektiven zugestehen, eigene Temperamente, eigene Wünsche, Meinungen, Gefühle. Wir müssen sie aushalten. Andere Menschen muss man ertragen lernen, im Großen gesprochen. Komischerweise fällt das bei Kindern schnell hintenüber, weil sie sich ja vermeintlich formen lassen. Dieses Aushalten des Fremden im Kind ist ganz bestimmt nicht leicht, denn wir schleppen ja unsere eigenen inneren Kinder mit uns herum.
Und ich möchte deutlich sagen, dass ich das auch schwer finde. Ich scheitere hundertmal am Tag. Und versuche es dann wieder und wieder und wieder. Keine Ahnung, was meine Tochter später mal über ihre Kindheit sagen wird. Ich möchte den Boden bereiten, auf dem sie ihre eigene Glückssaat ausstreuen kann. Das klingt kitschig, aber es beschreibt meine Motivation.

Neben deinem Elternblog »Kiddo The Kid« betreibst du noch die »Schattentiere«, der den vieldeutigen Untertitel »Wie ich einmal verrückt wurde und blieb« trägt. Wie bist du verrückt geworden? Wie verrückt bist du? Und was bedeutet es, verrückt zu sein?
Diese Frage habe ich zwei Wochen vor mir hergeschoben. Ich würde sie gern hemmungslos offen beantworten, aber das mache ich ja schon auf »Schattentiere« nicht – aus guten Gründen. Randnotizen gibt es natürlich schon: Ich habe seit sehr langer Zeit Panikattacken und Depressionen. Und ein paar andere fancy Sachen. Mal mehr und mal weniger präsent. Verdrängung hat für mich sehr lange sehr gut funktioniert.
Vor rund zehn Jahren eskalierte das dann innerhalb weniger Wochen. Am Ende konnte ich meine Wohnung nicht mehr verlassen – und da wusste ich: Scheiße, jetzt haste ein Problem. Eine Zeitlang war ich so richtig aus der Welt geworfen. Hinterher war alles verschoben; mein Wertesystem, mein Vertrauen in die Welt, meine Hoffnung für die Zukunft. Innendrin ist was kaputtgegangen, und es ist bis heute nicht verheilt. Im Rückblick kann ich sagen, ich hab das kommen sehen, konnte aber die Warnzeichen nicht verstehen. Heute bemerke ich viel schneller, wenn die Schwalben tief fliegen.
Verrückt bedeutet für mich: Ich bin meinem früheren Ich ent-rückt. Als hätte mich mal jemand abgepaust und dann ganz schlampig wieder auf das Original gelegt. Vielleicht bleibt das für immer so, ich weiß es nicht – aber es wird mir graduell unwichtiger. Als verrückt bezeichne ich mich aus Gründen der Selbstermächtigung. Man darf ja gar nicht verrückt sein im Sinne von »funktionsunfähig«, wir sollen uns alle ständig optimieren und was leisten. Da hat ein Verrücktsein, welches sich nicht eklektisch und kreativ äußert, sondern so blöd depri, keinen guten Ruf.
Deshalb habe ich beschlossen, mein Verrücktsein zu besitzen. Dazu gehört auch, dass ich mich damit nicht mehr verstecke. Vielleicht trauen sich dann auch andere, ihre eigene Verrücktheit in Besitz zu nehmen. Wenn wir uns den Begriff nehmen, ihn uns zu eigen machen, verliert er seine destruktive Kraft. Das ist nicht neu, die Fat Acceptance Bewegung verwendet den gleichen Hebel.
Verrücktsein ist auch nicht per se pathologisch – ich würde mir wünschen, dass wir den Spielraum des menschlichen Geistes breiter diskutieren, dann bräuchten wir auch weniger Begriffe. Vielleicht bin ich irgendwann nicht mehr verrückt. Oder muss es nicht mehr sagen. Oder es ist einfach total egal. Das weiß ich jetzt noch nicht.

Was schätzt du am Verrücktsein und was findest du unerträglich daran, verrückt zu sein?
Ich schätze daran gar nichts, während es passiert. Im Lauf der Jahre habe ich Demut gelernt, das ist in meinen Augen ein Geschenk, wenn auch ein melancholisches. Und ich habe wahrscheinlich mehr Empathie für andere Menschen übrig als früher. Wenn man lernt, sanfter zu sich selbst zu sein, ist man es auch zu anderen.
Unerträglich finde ich die akuten Phasen. Auf »Schattentiere« verarbeite ich die in den Kaleidoskop-Einträgen. Diese Momente, wenn nichts mehr ist. Die Leere. Die Überzeugung, dass es dieses Mal für immer so bleibt – ja, das ist vielleicht das Schlimmste. Irgendwann wird es heller, aber das weiß man in den dunklen Stunden und Tagen einfach nicht. Jedes Mal die Angst, dass es das jetzt wirklich war mit dem schönen Leben. Daraus aufzutauchen, ist immer wieder ein Wunder.
Alle Bilder © Liz Birk via Instagram
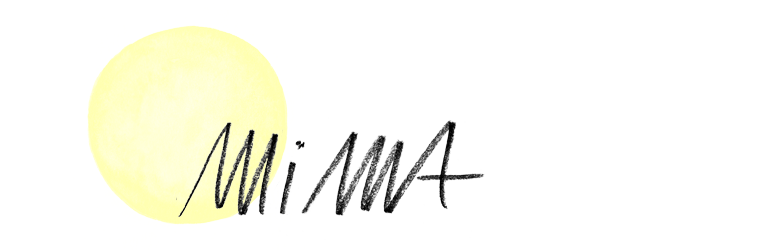


Nun mal also an dieser Stelle und weil es mir ein echtes Bedürfnis ist, Liz einmal zu sagen, wie großartig ich sie finde und das, was sie schreibt. Gewisser Weise ist sie die einzige unter den Mama-Autorinnen, die ich lese, ohne mich an irgendeinem Punkt fremd zu fühlen. Ich liebe, wie du deine Worte um euren Alltag setzt und bildest, Liz. Da draußen gibt es ja inzwischen so viele Eltern, die schreiben – aber du kannst es eben auch: mit Worten umgehen. Und so lesen sie sich, deine Worte, dein Blog wie Poesie. Übrigens ist mir wie den meisten deiner Lesern wahrscheinlich recht schnuppe, wann und in welchen Abständen irgendetwas von dir erscheint – weil es in diesen Tagen eben nicht so sehr von wert ist, wieviel da draußen geschrieben steht – sondern wie es geschrieben ist. Ich lese lieber nur zwei Mal im Jahr deine Texte, als jede Woche irgendeinen Nonsens an anderer Stelle. Katharina
Wunderbare Worte. Ich liebe so wortgewandte Menschen.
Liebste Grüße
Eva
Danke für den Tip – das Interview finde ich toll und es macht wirklich Lust, mehr über Liz zu erfahren.
Viele Grüße
die Frau S.
Ein so tolles Interview mit tollen Fragen und Antworten und Gedanken. Danke dafür!
Dieses Interview hat mir mit seinen Fragen und Antworten aus der Seele gesprochen, wie es nur wenige tun. Danke Indre und Liz für diesen schönen Montagsmoment!