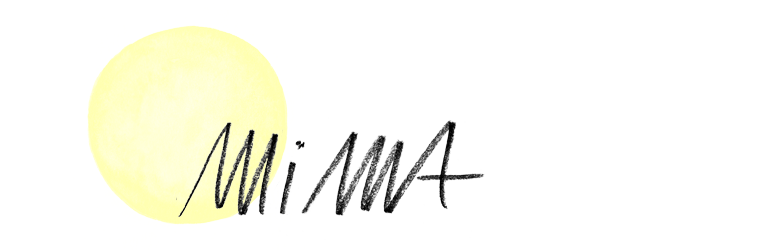Aufgewachsen auf dem Dorf, wohnhaft in Berlin ist die Sehnsucht nach dem Land ihre stete Begleiterin. Die kann man entweder als quälend oder aber als anregend erfahren – je nachdem ob man ein*e Schalk*in im Nacken sitzen hat oder nicht. Schaut man Karin Lubenau aufmerksam auf den Hinterkopf, so sieht man da ganz sicher dann und wann leise lachend eine*n durch ihre Haare luken. Ich stell sie mir als kleine Punkerin mit buntem Iro und Ring in der Nase vor oder als eine Pippi Langstrumpf – in jedem Falle aufmüpfig und keck und frech und mutig. Denn was anderes passt einfach nicht zu jemandem, die mit ihren Töchtern Hosentaschenschätze findet, gern in Gummistiefeln geht, von Hühnern in Hinterhäusern träumt und Autokorrekturen korrigiert.
Was sie vom kleinen Dorf in die Großstadt verschlug, wie sie das innere {Dorf-}Kind bewahrt, was die Illustration dem Foto voraushat und warum Rosa eigentlich eine verwegene Farbe ist – um das und mehr geht es im heutigen Montagsinterview, mit dem ich trotz oder gerade wegen des mitternächtlichen Debakels guten Start in die neue Woche wünsche und für das ich dir, liebe Karin, ganz herzlich danke.

Du bist in Huisberden, einem 200-Einwohner*innen-Dorf am Niederrhein, aufgewachsen und lebst jetzt in der 3,5-Millionenstadt Berlin. Ist das nur folgerichtig oder reiner Zufall? Und wenn es der Zufall war, wie führte er dich her?
Der Zufall, der Studienplatz, die erschwingliche {es war einmal…} große kreative Stadt. Das war kein großer Plan, ist einfach so passiert – das Leben eben. Vom Carport zum Parkplatzproblem. Vom Dorfkind ins Millionendorf. Mein Kiez, also meine paar Hektar Neukölln, sind mein Dorf in der Stadt. Hier kenne ich den Bäcker und der Bäcker kennt mich. Ich hab hier mein dörfliches Netz an Freunden, Bekannten und Nachbarn die mir begegnen, helfen und mit denen man Lust hat, seinen Kiez zu gestalten. Der städtische Vorteil ist hierbei auf jeden Fall, das ich eine Auswahl aus vielen Menschen treffen kann. Meine kleine Filterbubble an Gleichgesinnten.
Ich hatte als Kind ganz klar den Vorteil, in Wald und Wiesen zu verschwinden und frei und unbeobachtet zu sein. Wenn wir Kinder dann schmutzig nach Hause kam, mussten wir durch den Keller rein, raus aus Gummistiefel und Kordhose und sonntags rein in die guten Klamotten und ab in die Kirche. Auf dem Dorf macht man für den Pfarrer Platz, hier für den Hundekotstaubsauger. Was man mitnimmt als Dorfkind: Man braucht Fahrgemeinschaften, um zur nächsten Scheunenfete zu kommen. Man organisiert sich.
Bei aller Liebe hab‘ ich Berlin manchmal so satt. Du auch? Was machst du dann mit diesem Gefühl? Oder wie gelingt es dir, nicht genug zu bekommen von dieser Stadt?
Ich mag Berlin, das Bunte, das Laute, das Schnelle und das immer wieder Neue. Ich mag die Leute, die Berlin anzieht. Es bedient meine Neugierde. Das ist allerdings auch das Problem: schnell, schneller am Schnellsten. Ich erde mich mit Hände-in-die-Erde-stecken. Wir haben einen Kleingarten, der ist im Sommer unser zweites Zuhause. Es gibt ein großes Bedürfnis nach Natur und Draußensein und Berlin hat schöne Grünflächen und ein tolles weites Umland, in das immer mehr Freund*innen ziehen, die besucht werden wollen. Ist ja auch einsam da draußen 😉. In Gummistiefeln fühlt sich die große Karin genau so wohl wie die kleine Karin.
Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wie ich leben will, dann wäre es ein Haus im zweiten Hinterhof mit einen Hektar Land oder ein Dachgarten mit Hühnern.
Manchmal hab ich Sehnsucht nach Tütties {Hühner auf Niederrheinisch}. Mal sehen wo das hinführt. Vielleicht ein Dachgarten mit Hühnern? Kein Fahrplan – passt ja auch irgendwie zu Berlin.
Studiert hast du in Hannover, der Stadt meiner Jugend, die weiß Gott keine Schönheit ist, aber ihre schönen Seiten hat. Welche waren das für dich?
200 Einwohner*innen > 500 000 Einwohner*innen > 3 500 000 Einwohner*innen – klingt jedenfalls nach einem stringenten Lebenslauf. Das Schöne an Hannover war das Studieren – ich hab es geliebt. Unter anderen Kreativen kreativ gefordert zu sein, neue Leute kennenzulernen, viel feiern und neue Freiheiten. Hannover war eine gute Zwischenstation.
So, genug der Orte. Du bist als freie Illustratorin tätig. Wie gehst du vor, wenn du einen Arbeitsauftrag erhältst und wie unterschiedet sich dein Heran- und Vorgehen von einer freien Arbeit?
Ich darf mich durch meine Arbeit hin und wieder in neue Welten einarbeiten, Zielgruppen verstehen und in andere Sichtweisen einnehmen. Das kommt meiner Neugierde und Lust, Menschen zu verstehen und zu begreifen, sehr entgegen. So komme in Bereiche, die ich vorher noch nicht kannte. Es eröffnen sich hier und da neue Interessen, von denen ich noch nichts wusste.
Freie Arbeiten sind immer auch ein wenig therapeutisch, sie behandeln die Themen die mich beschäftigen. So eine kreative Auseinandersetzung ist ein großer Luxus, den ich mir ab und an gönne.

Deine letzte freie Arbeit heißt »Mit ohne Rosa« und zeigt Mädchen, die freche und frei Sachen machen, die nicht unbedingt ins gängige Rollenbild passen, zum Beispiel lustvoll in der Nase bohren, Skateboard fahren oder auf Elefanten voltigieren. Was hat dich zu dieser Serie veranlasst?
»Mit Ohne Rosa« ist eine Ode an mein Mädchen, das kleine Mädchen in mir und geht raus an alle Mädchen. Die Plakatserie soll unser gängiges Rollenbild korrigieren und in Frage stellen. Daher spiele ich hier ganz bewußt mit Begrifflichkeiten und ordne ihnen neue Bilder zu. Gegen die Pinkifizierung. Gegen Geschlechterschubladen.
Warum gibt es Rabauken, aber keine Rabaukinnen. Meiner Autokorrektur musste ich das Wort erst beibringen – traurig.
Mädchen sollten nicht als zickig gelten, wenn sie ihre Meinung sagen, sondern sich frech und mutig die Welt erobern. Rosa ist ja nicht scheiße, wird nur als Farbe missbraucht. Ich will mein Mädchen frei, wild und wenn sie mag auch gerne schick. »Mit ohne Rosa« ist für Mädchen, mit denen man Einhörner stehlen kann. Für Handwerkerinnen mit Sternenschein. Schicke schmutzige Girls brauchen Vorbilder!
Worin siehst du deine Aufgabe und Rolle als Illustratorin?
Illustration bringt Dinge den Menschen näher. Informationen werden kurz und übersichtlich zusammengefaßt. Der Blick wird gelenkt, Absurdes hervorgeholt. Optimalerweise regt sie zum Nachzudenken an.
Im Unterschied zum Foto hat eine Illustration den Vorteil, dass man zum Beispiel durch Übertreibung oder Weglassen Unscheinbares sichtbar machen kann. Bilder prägen unseren Blick auf die Welt und sind schnell erfassbar. Sie schaffen eine zusätzliche Ebene zum Text und geben so mehr Spielraum für neue und eigene Assoziation. Ganz nebenbei ist sie auch noch schön. Ich mach die Welt also ein bisschen besser. So wie sie mir gefällt – frei nach Pippi Langstrumpf.
Ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, komplex-komplizierte Sachverhalte in Erzählungen {neudeutsch: Storys} zu übersetzen, die man im besten Falle gerne hört und sich darin wiederfindet. Was könnte ich bei dieser Aufgabe von dir und deiner Arbeitsweise lernen bzw. übernehmen?
Ich bin eine gute Beobachterin, sehe oft kleine Absurditäten. Stecke mir genau so Stöcke in die Taschen wie meine Kinder und kann sie als Schatz betrachten. Ich hab eine gute Vorstellungskraft und kann das Potenzial gesammelten Schätze erkennen. Mein Kopf funktioniert mehr in Bildern als in Worten. Ich habe zum Beispiel bei Begegnungen mit Menschen sehr oft Assoziationen mit Zeichentrickfiguren, Bilder tief in meiner Erinnerung. Es laufen also öfter Herr von Bödefeld, Tiffi, Maja, Willy, Kasimir, Nepumuk, die Quietschboys, Peter Lustig, die Fraggels, Emilie Erdbeer, Karlsson und andere an mir vorbei – ich freu mich. Es schadet sicherlich nicht, das Kind in sich nicht zu bewahren.
Die Bilder sind alle von Karin Lubenau. → Mehr von ihr und über sie findet ihr auf www.mitliebegemacht.de