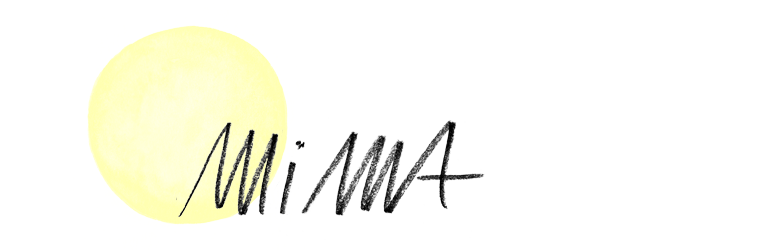Es gibt viele gute Gründe, seinen Lebensmittelpunkt nach Hamburg zu verlegen. Am meisten überzeugt mich Isabel Bogdans Begründung: »Weil es da so schön ist.« Sollte ich wieder einmal danach gefragt werden, warum ich {immer noch} in Berlin lebe, werde ich genau das erwidern. Entweder ist das Gespräch damit jäh beendet oder es wird genau jetzt interessant.
Die preisgekrönte Übersetzerin und Autorin, die mit ihrem ersten Roman »Der Pfau« direkt den großen Coup landete, bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. Ihre Rezensent/innen sprechen von »subtilem Humor«, was sicher die korrekte Bezeichnung für das ist, was in mir wirkt, wenn ich ihre Texte lese. Die Wirkungskette ist immer ähnlich: Erst setzt der »Ja klar, ich weiß, wovon du sprichst«-Reflex ein, der sich sogleich in sein Gegenteil verkehrt: »Hä, was sagt die da?«. Darauf folgt ein Moment geistiger Leere, in dem ich mir sehr einfältig vorkomme, mein Hirn aber vermutlich Höchstleistungen vollbringt. Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, wie es zu der anschließenden Reaktion kommt: plötzliche Erkenntnis gepaart mit mehr oder weniger stillvergnügter Heiterkeit – manchmal muss ich auch laut lachen, wie zum Beispiel bei ihren Antworten auf Google-Suchanfragen:
»eier gucken aus der hose
Ist ja auch bald Ostern.
wozu braucht man figurale intelligenz
Zum Einparken«
Im heutigen Montagsinterview mit Isabel Bogdan geht es unter anderem um die Kunst des Übersetzens, um den Unterschied von fiktivem und faktischem Schreiben und Kommunikation in virtuellen und »Kohlenstoffwelten«. Vielen Dank, liebe Isabel, für das heitere Gespräch mit dem ich allen einen stillvergnügten Start in die neue Woche wünsche.

Du arbeitest täglich mit und in der Sprache. Was ist Sprache für dich und wie ist dein Verhältnis zu ihr?
Sprache fasziniert mich nach wie vor. Was sie alles kann! Und was für Möglichkeiten für Missverständnisse sie bietet! Wahrscheinlich ist die Komplexität unserer Sprache das, was uns von den Tieren unterscheidet. Wir brauchen Sprache, um uns die Welt zu erklären, zum Denken. Und ich finde es auch spannend zuzusehen, wie sie sich verändert, wie sie immerzu im Fluss ist, und dauernd selbst abzuwägen, wo ich sprachbewahrerisch tätig sein möchte, und wo ich neu eingewanderte Gewohnheiten übernehme. Mit solchen kleinen Entscheidungen kann man in der Literatur unterschwellig viel rüberbringen, und das macht großen Spaß.
Gut übersetzte Romane sind ein großes Glück, das mir gottlob öfter widerfährt. Worin besteht die Kunst des literarischen Übersetzens?
Darüber könnte ich wahrscheinlich einen mehrstündigen Vortrag halten. Kurz gesagt: Die Kunst des literarischen Übersetzens besteht darin, nicht nur Wörter und Sätze zu übersetzen, sondern auch die unsichtbaren Beziehungen zwischen den Wörtern und Sätzen. Wenn man nur den Sinngehalt überträgt, ist ein Text tot. Für Literatur braucht es die Schwingung dazwischen, Rhythmus, Klang, Stilebene, eben das, was die Literatur etwa von juristischen oder technischen Texten unterscheidet. Und genau das macht für mich die Freude am Literaturübersetzen aus. Den richtigen Sound für jedes Buch zu finden.
Worin besteht für dich der größte Unterschied zwischen literarischem Übersetzen und literarischem Schreiben?
In der Angst vor dem leeren Blatt. In der tiefsitzenden Überzeugung, dass mir nichts einfällt. Beim Übersetzen hat man diese Angst nicht, da steht ja immer schon etwas. Dadurch sind beim Schreiben auch die Erfolgs- und Frustrationserlebnisse größer.
»Sprache fasziniert mich. Was sie alles kann! Und was für Möglichkeiten für Missverständnisse sie bietet!«
Du hast auch Sachbücher übersetzt und ein Buch übers »Sachen machen« geschrieben. Wie anders ist diese Art des Übersetzens und Schreibens im Vergleich zum Literarisch-Fiktiven?
Die Sachbücher, die ich übersetzt habe, waren zumeist erzählende Sachbücher, die also auch so etwas wie einen eigenen Ton hatten. Da lag der Unterschied oft vor allem darin, dass mehr zu recherchieren war. Beim Schreiben war es so, dass das Sachenmachenbuch sich fast von allein geschrieben hat, denn da habe ich Dinge unternommen und ausprobiert und hinterher aufgeschrieben, wie es war. Da hatte ich die Angst vor dem leeren Blatt nicht, denn ich wusste ja, was zu schreiben war. Einen Roman zu schreiben, war ganz anders, da ist man allein mit seinen Gedanken und seinem Worddokument und meint erstmal, man müsse aus dem Nichts schöpfen. Das muss man aber gar nicht! Man muss nur Vorhandenes neu zusammensetzen, aber bis ich das verstanden hatte, hat es lange gedauert. Und wirklich verinnerlicht habe ich es immer noch nicht.
Es heißt, Erfolg verändere. Dein erster Roman »Der Pfau« hat dich innert kürzester Zeit zu einer erfolgreichen Schriftstellerin gemacht, nachdem du schon preisgekrönte Übersetzerin warst. Wie haben deine Erfolge dich verändert?
Ich hoffe, gar nicht! Aber meinen Lebensrhythmus hat es erstmal verändert. Als Übersetzerin sitzt man im Wesentlichen zu Hause am Schreibtisch, und wenn man mit einem Buch fertig ist, macht man das nächste. Das hat eine Menge Vorteile, aber eigentlich bin ich zu kommunikativ für einen so einsamen Job.
Als Autorin war ich letztes Jahr sehr viel auf Lesereisen, ich hatte insgesamt 73 Veranstaltungen. Eigentlich müsste ich mal ausrechnen, wie viele Bahnkilometer ich gefahren bin und in wie vielen Betten ich geschlafen habe. Ich hatte plötzlich Publikum und habe lauter tolle Leute kennengelernt, das war schon sehr schön. Und anstrengend auch. Jetzt wird es wieder ruhiger, ich mache weniger Lesungen, übersetze wieder (Erzählungen von Jane Gardam), und danach schreibe ich hoffentlich den nächsten Roman. Der Alltag geht also langsam wieder back to normal. Ich selbst bin hoffentlich sowieso noch die Alte.
Nicht zuletzt als Bloggerin bist du viel in der Netzwelt unterwegs. Wie erlebst du die Sprache und den Umgang mit Sprache dort?
Ich bin im Netz offensichtlich in einer ziemlichen Ausnahmeblase unterwegs und kommuniziere mit tollen, eloquenten, witzigen, kreativen Leuten, aber das ist sicher nicht repräsentativ. Wenn ich aus Versehen mal auf Zeitungsseiten die Kommentare lese, was ich meiner Psychohygiene zuliebe normalerweise vermeide, dann wird’s mir angst und bange. Allerdings eher aus inhaltlichen als aus sprachlichen Gründen. Sprachliche Genauigkeit und Eloquenz sind nicht jedermanns Stärken, das hat aber erstmal nichts mit dem zu tun, was jemand sagt.
»Wenn alles von mehr Menschenfreundlichkeit durchdrungen wäre, wäre die Welt eine bessere.«
Wenn du einen Wunsch frei hättest, welche Sprach- und Kommunikationskultur würdest du im Internet etablieren? 2016 war für dich persönlich ein sehr gutes, weltpolitisch ein eher verstörendes Jahr. Was wünschst du dir für 2017?
Die Fragen beantworte ich mal zusammen. Ich wünsche mir, dass die Menschen freundlich zueinander sind, im Großen wie im Kleinen. Menschenfreundlichkeit und Empathie sind eine Lebenseinstellung, das hat mit Sprachgebrauch erst in zweiter Linie zu tun. Und es macht für mich auch keinen Unterschied, ob man im Internet oder draußen in der Kohlenstoffwelt kommuniziert – wenn alles von mehr Menschenfreundlichkeit durchdrungen wäre, wäre die Welt eine bessere. Vielleicht ist sie ja ansteckend, alle freundlichen und positiv gestimmten Menschen sollten darum dafür sorgen, dass sie präsent sind und dem Hass etwas Konstruktives entgegensetzen.
Fotos: Smilla Dankert