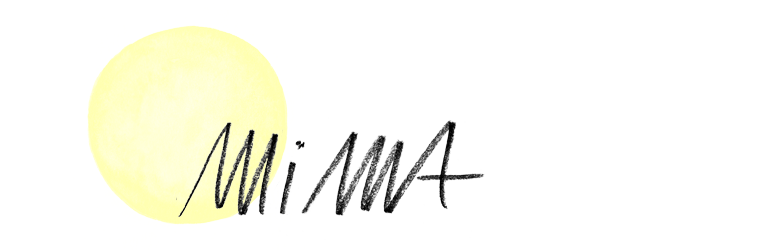Es gibt keine Alternative zum optimistischen Blick auf die Welt, ist Ina Schmidt überzeugt und meint damit nicht die »rosarote Brille«. Für die promovierte Philosophin ist Optimismus eine Form der aktiven Gelassenheit, einer sich seiner eigenen Möglichkeiten und Grenzen bewussten Haltung, die genau hinsieht und im »Sehen standhält« (Karl Jaspers). Das macht für die dreifache Mutter, die mit ihrer Familie in der Nähe von Hamburg lebt, zugleich auch das »mündige, autonome Individuum« aus.
Dr. Ina Schmidt ist studierte Kulturwissenschaftlerin und hat über den Einfluss der Lebensphilosophie auf das frühe Denken Martin Heideggers promoviert. Im Jahr 2005 gründete sie die denkraeume aus dem Bedürfnis heraus, einen Ort zu schaffen, an dem sie die Philosophie als Form der Lebenspraxis vermitteln kann, denn – so ihre Überzeugung – »die Philosophie ist eine wertvolle Expertin, um theoretisch zu klären, was praktisch zu tun ist«.
»Das Leben ist kein Produkt, sondern eine Praxis« Hannah Arendt
Im heutigen Montagsinterview erzählt sie, wie sich die denkraeume in den 12 Jahren ihres Bestehens entwickelt und verändert haben, wie die Philosophie im alltäglichen Leben helfen kann (z.B. im Umgang mit der Digitalisierung), warum wir Narrative brauchen und in Zeiten wie diesen optimistisch bleiben können.
Ich danke Ihnen, liebe Frau Schmidt, für dieses unglaublich inspirierende Gespräch, mit dem ich allen einen wunderbaren Start in die neue Woche wünsche.

2005 haben Sie die denkraeume ins Leben gerufen, um Philosophie als Form der Lebenspraxis zu vermitteln und akademische Wissenschaft mit Fragen der Gegenwart zusammen zu denken. Wie kam es dazu?
Während meines Studiums der Kulturwissenschaften bin ich immer wieder auf Fragen gestoßen, die von welcher Seite auch immer kommend das Verhältnis von »Philosophie« und »Leben« zum Thema hatten: Ethische Grundgedanken im Zusammenhang von Wertewandel oder die Frage nach dem guten Leben in kulturhistorischen Fragen, die Bedeutung medialer Kommunikation und all das, was in diesem interdisziplinären Angebot damals eine Rolle spielte. Das war nicht immer ursächlich philosophisch, die Klärung der eigenen Haltung als »Fragende« warf aber immer und immer philosophische Grundgedanken auf und letztlich war es das, was mich am meisten interessierte:
Welche Rolle spielt die Haltung des Philosophierenden für seine Gedanken, wie lässt sich das Denken als Gegenstand des Denkens thematisieren und wie gelingt die schwierige Balance, etwas so Irrationales wie das »Leben« mit Hilfe rationaler Gedanken fassen zu können?
Das waren oft sehr persönliche Fragen, die in der Philosophie aber schon seit über 2.000 Jahren gestellt wurden und sehr unterschiedlich beantwortet wurden.
Gegen Ende meines Studiums habe ich begonnen, mich mit der »Lebensphilosophie« zu beschäftigen, weniger einer eigenen Denkschulde als eher einer philosophischen Strömung, die immer dann sichtbar wurde, wenn das mechanistische Vernunftdenken in der Philosophie Überhand zu nehmen schien, also so etwas wie ein geistiges Korrektiv. Mit diesen Schwerpunkten hatte ich oft den Eindruck innerhalb der akademischen Philosophie an eine »Grenze« zu stoßen, die zwar beständig thematisiert wurde, aber doch eher etwas zu meidendes darstellte: für philosophische Debatten schienen diese Fragen, die auch mit persönlicher Lebensführung oder der Rolle des einzelnen Sinnsuchers zu tun hatten, zu konkret, zu alltäglich, ja – zu banal.
Aber genau das hat mich interessiert, wie kann Philosophie im Alltag funktionieren, wie kann sie sich verständlich machen für Menschen, die zwar jede Menge philosophische Fragen stellen, aber keinen philosophiehistorischen Hintergrund mitbringen? Und – ist es nicht gerade die Aufgabe ausgebildeter Philosoph*innen, genau diese Vermittlung möglich zu machen? Nun habe ich Kulturwissenschaften studiert und zu Beginn der 1990er Jahre die Wirren gelebter Interdisziplinariät ziemlich hautnah mitbekommen, aber genau das machte für mich die Notwendigkeit einer philosophischen Sprache deutlich, die sich nicht in wortgewaltige Theorien zurückzieht, sondern Brücken im Denken baut, Begriffe klärt, und das schärft, was wir mit unserem Geist dazu beitragen können – Philosophen oder nicht. Und das war dann der Beginn der denkraeume.

Die denkraeume gibt es nun seit 12 Jahren. Was ist in dieser – doch recht langen Zeit – passiert? Was hat Sie besonders erfreut, was überrascht?
Die denkraeume sind als eine Art »Feldversuch« gestartet, als Idee einer konkreten philosophischen Praxis, in der er es Gesprächsangebote insbesondere für Menschen geben sollte, die mit Sinnfragen oder Entscheidungssituationen konfrontiert sind. Im Lauf der Zeit habe ich allerdings festgestellt, dass die Idee einer philosophischen Praxis sich für mich eher methodisch stellt und viel mehr »philosophisches Potential« entsteht, wenn das Gespräch in einer Gruppe stattfindet – ein wenig in Anlehnung an die Tradition der griechischen Antike, die im öffentlichen Raum, auf dem Marktplatz und als angeleitetes Gespräch unter mehreren stattfand.
Diesem Weg bin ich entgegen der ursprünglichen Idee gefolgt und es sind über das Gespräch hinaus Themen entstanden, die sich auch in Texten und Büchern weiterentwickelt haben – auch um für mich selbst Klärungsprozesse voranzutreiben. Die Bücher, die ich geschrieben habe, sind alle aus persönlichen Fragestellungen heraus entstanden und auch nur dann hat ein Thema sich wirklich zu einer These entwickelt. Andere Ideen, die möglicherweise »besser funktioniert« oder dem Zeitgeist angemessener gewesen wären, sind einfach nicht weitergewachsen.
Die denkraeume sind also wirklich so etwas wie ein eigener kleiner Kosmos geworden, der weniger durch äußerliche Räumlichkeiten, sondern eher durch meine eigenen Fragen und Gedanken zusammengehalten wird und dass daraus wirklich eine Art stabiles Geflecht entstanden ist, aus Orten, Menschen und immer wiederkehrenden Themen wie z.B. das der Freundschaft oder der Gelassenheit oder auch Bildungsfragen, die gerade in Zusammenhang mit dem Kinderbuch mehr und mehr gestellt werden, ist für mich ebenso überraschend wie großartig.
Zu Beginn meiner Tätigkeit hatte ich ein sehr viel »unternehmerischer« ausgerichtetes Bild von den denkraeumen, aber sie hatten offenbar ihren eigenen Kopf und es gab immer wieder Neues auszuprobieren, und ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeiten hatte, dem mitten in einem turbulenten Familienleben folgen zu können.

Wie verstehen Sie Philosophie und wie kann die »Liebe zur Weisheit« im alltagspraktischen Leben weiterhelfen?
Für mich ist die Philosophie eine besondere Art, auf die Welt zu schauen und sie ganz im Sinne einer meiner Lieblingsdenkerin Hannah Arendt »verstehen zu wollen«.
Es geht nicht um Erklärbarkeit oder Rechthaberei, auch nicht um Lösungen oder einen konkreten Nutzen, den die Philosophie zur Verfügung stellen kann, sondern darum, durch diesen scharfen und hin und wieder überaus mutigen Blick zu lernen, sich selbst als Teil eines Ganzen zu sehen, das sich nur durch Abstraktion oder durch vollständige Hingabe eröffnet.
In der Philosophie ist die Phänomenologie die Methode, die durch genaue Betrachtung, Beobachtung und sprachliche Differenzierung »zu den Sachen selbst« (Edmund Husserl) kommt und so zeigen kann, welche Lösungen keine sind, wo es offene Fragen gibt und was möglicherweise vielleicht nicht nützlich, aber letztlich doch das einzig »Gute« ist.
Wenn Philosophie die Fähigkeit ist, sich auf wohlwollende Weise (und damit ganz aristotelisch) zu sich selbst und der Welt ins Verhältnis setzen zu können, dann schafft philosophisches Denken die Voraussetzung für viele Fähigkeiten, die heute gefragt sind, sofern sie sich nicht in ihren Elfenbeinturm zurückzieht: von Agilität, dem Umgang mit komplexen Aufgabenstellungen, dem Aushalten von Unsicherheit und Wandel und der Fähigkeit, auch im Alten, das Neue sehen zu können.
Philosophen haben sich schon immer dadurch ausgezeichnet, sich nicht auf vermeintlichen Selbstverständlichkeiten auszuruhen, das kann zu einem grüblerischen und verzweifelten Leben Anlass geben, es kann aber auch eine Stärkung bedeuten, die die eigene Autonomie und das selbstbestimmte Denken und Handeln des einzelnen in den Vordergrund rückt, ohne dabei ins selbstverliebten Egozentrismus abzugleiten – denn (wenn auch unter Philosophen durchaus anzutreffen) eine solche Haltung zur Welt ist alles Mögliche, hat aber am Ende mit der „Liebe zur Weisheit“ – der griechischen Wortbedeutung von Philosophie – rein gar nichts gemein.
Sie haben über Martin Heidegger promoviert, einen Denker, zu dem ich nie recht einen Zugang gefunden habe. Was schätzen Sie an ihm? Womit hadern Sie?
Martin Heidegger hat sich in seiner frühen Schaffensphase mit den Denkern und Vertretern der Lebensphilosophie beschäftigt und in den frühen 1920er Jahren diesen Einfluss deutlich gemacht und weiterzudenken versucht. Das war als Thema für ein Dissertationsprojekt damals eine interessante Möglichkeit: das lebensphilosophische Denken auch an seinen Grenzen, seinen Stärken und Schwächen in Verbindung mit dem sehr viel »systematischeren« Denkens Heideggers auszuloten.
Heidegger (und damit meine ich wirklich den frühen Philosophen bis zu »Sein und Zeit«, das 1927 erschienen ist) war zu der Zeit faszinierend in seiner fast revolutionären Art mit der akademischen Tradition umzugehen und sich auch als Person und Philosoph ziemlich eigenwillig zu präsentieren. Heidegger war ein brillianter Denker und scharfsinniger Beobachter, auch wenn ich während meiner Promotionszeit nie so etwas wie eine wirkliche Nähe zu seiner Philosophie entwickelt habe (das war bei Karl Jaspers und Hannah Arendt z.B. völlig anders, die mich in ihrem Denken und Leben gleichermaßen beeindruckt haben).
Das größte Problem aber war natürlich seine Nähe zum nationalsozialistischen Denken und eine Gesinnung, die spätestens seit der Veröffentlichung der Schwarzen Hefte nochmal deutlich gemacht hat, wie weit diese Nähe trotz der äußerlichen Distanz ging – auch wenn Heidegger den Nationalsozialismus als politische Kraft nur kurz öffentlich unterstützt hat. Die Frage, ob und wie sich ein solcher Philosoph eignen kann, um darauf die eigenen Gedanken aufzubauen, kann man nur verneinen.
Ich zitiere ihn kaum noch, merke aber doch, wie prägend so mancher Gedankengang gewesen ist und wie großartig ich einige seiner Texte nach wie vor finde (auch die späten wie z.B. die Rede zur Gelassenheit aus den 50er Jahren). Diese persönliche Ambivalenz wird bleiben, aber gerade im Gedenken an Heidegger und der Rolle, die er in und für die Philosophie spielen kann, sollte sehr viel deutlichere Kritik an seinen antisemitischen und rückwärtsgewandten Positionen geübt werden. Als Vorbild taugt Heidegger nicht und ich hätte ihn heute auch nicht mehr als zentralen Denker für mein Dissertationsprojekt gewählt.

Ihr aktuelles Thema ist das »Narrativ«. Welche Bedeutung hat die »Erzählung« Ihres Erachtens für den einzelnen Menschen wie auch für eine Gesellschaft?
Das »Narrativ«, das ja derzeit gern und häufig bemüht wird, wenn es um Zukunftsentwürfe, Visionen oder Bilder geht, die wir z.B. von Europa oder der Zukunft der Demokratie zeichnen oder entwickeln wollen, ist für mich eine notwendige Kategorie für das, was Wirklichkeit stiftet, sich aber dem Denken in Berechnungen und Prognosen entzieht. Eine Kategorie, die wir dringend nötig haben und aus dem Schattendasein eines gutmenschenartigen Märchenerzählens oder maximal dem realitätsfernen Entwerfen von Utopien befreien sollten.
Unsere Leben sind persönlich wie gesellschaftlich bestimmt von Narrativen und oft genug erzählen wir uns Geschichten, ohne es zu bemerken – ohne also festzustellen, dass wir sie anders erzählen könnten, dass wir Protagonist*innen sind und Einfluss nehmen könnten.
Wer sagt, was gut und was böse ist? Wer erklärt uns, wie Gleichberechtigung funktioniert oder gute Erziehung auszusehen hat? Auf diesen Erzählungen beruht unser Menschen- und Weltbild und gestützt von wissenschaftlichen Erkenntnissen und historischen Erfahrungen entwickeln sie sich beständig weiter. Narrative haben nichts mit der Abwesenheit von Wirklichkeit zu tun oder einem Mangel an »Faktizität« oder wie auch immer man es aus einer eher mechanistischen Denkwelt heraus kritisieren wollte, sondern sind Ausdruck einer Welt, der wir uns eher verstehend als erklärend nähern sollten.
Solche Erzählungen sind die Essenz eines kulturellen Wissens, das wir durch Interpretationen zugänglich machen, sie sind notwendige Orientierungsmuster, die wir durch Erfahrungen und Erinnerungen, durch kulturelles Wissen und Traditionen hindurch entworfen und immer weiter entwickelt haben. Narrative geben so der Welt »Bedeutung«, und ohnedem wäre die Welt nach Hannah Arendt nur ein »Haufen beziehungsloser Dinge« – ohne jede Bedeutung.
Narrative, die bis vor wenigen Jahren noch getragen haben, wie die Erzählung von Europa, von der freiheitlichen Demokratie oder den Menschenrechten, verlieren ihre Bindungskraft. Wie erklären Sie sich diese Entwicklungen und wie bewerten Sie sie?
Ich denke nicht, dass diese »Narrative« ihre Bindungskraft verlieren, sondern dass wir ihnen weniger vertrauen. Die Schriftstellerin Juli Zeh hat in ihrem Roman »Unterleuten« den schönen Satz geschrieben, dass wir das »Gute« mit dem »Eigenen« verwechseln und genau das scheint uns gegenüber Narrativen misstrauisch zu machen, die gemeinschaftlich angelegt sind, die keinen unmittelbaren »Nutzen« versprechen – schon gar nicht für den/die einzelne*n.
Es geht schlicht nicht um mich, wenn der Wert der Demokratie auf dem Prüfstand steht, die Zukunft Europas hängt auch von mir, aber nur sehr marginal ab und das, was daraus entsteht, mag meinen Kindern und Enkeln, aber mir wahrscheinlich nicht unbedingt zu Gute kommen.
Ein Narrativ, das die Frage: »Was bringt mir das?« in den Mittelpunkt des Weltgeschehens stellt, ist mit dem, was wir an Traditionen oder sozialen Institutionen aufgebaut haben, kaum zu vereinbaren und wir brauchen gesellschaftlich aktive Persönlichkeiten und Vorbilder, die genau das klar machen.
Dazu brauchen wir eigentlich nur genau hinzuschauen, um zu erkennen, dass die Richtung, die wir gegenwärtig einschlagen, nicht zu einem »guten Leben« führt: gerade das »Narrativ« des einzelnen, der sein Glück (selbst) macht und sich von Superlativ zu Superlativ optimiert, den perfekten Körper inklusive ewigwährender Jugend verspricht und Unverbindlichkeit mit Freiheit verwechselt, erzeugt ja gerade die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, die eine Alternative zur ewigwährenden egomanen Nabelschau sein kann und das Problem einer metaphysischen Obdachlosigkeit wieder zur gemeinsamen Fragestellung macht. Und hier hilft weder der Blick zurück in die »guten alten Geschichten« noch eine Ansammlung an Fakten und kognitiven Überzeugungen, hier kann nur ein Narrativ helfen, eine »Vision«, die das Zusammenhänge schafft und damit sinnstiftend wirken kann.

In einem Ihrer aktuellen Aufsätze gehen Sie der Frage nach, was ein gutes Leben in einer digitalen Welt ist. Wie lautet Ihre Antwort?
Ein gutes Leben in einer digitalen Welt braucht die Fähigkeit eines autonomen Individuums sowohl »Ja« als auch »Nein« zu den digitalen Angeboten und technischen Möglichkeiten sagen zu können, die es umgeben. Wahrscheinlich ist das für jemanden, der noch mit einem Bein in der analogen Welt groß geworden ist, eine andere Aufgabe als für einen waschechten Digital Native oder meine eigenen Kinder, die manches in der digitalen Welt überhaupt nicht mehr als »Angebot« oder Möglichkeit ansehen, sondern als unverrückbare Realität. Ich halte wenig von Grabenkämpfen zwischen einer alten und einer neuen Welt und denke, es gilt auch hier, das Beste aus beidem zu vereinen.
Denn auch in der digitalen Welt bleibt vieles von dem gut, was in der analogen Welt seine Bedeutung hatte. Ich habe mich viel mit dem Phänomen der Freundschaft beschäftigt und auch wenn es so scheinen mag, als würden die sozialen Netzwerke und all die »friends«, die in der digitalen Welt per Klick erreichbar sind, die Praxis der Freundschaft vollständig verändern, so sind die Werte, die Wünsche und Sehnsüchte, die darunter zum Vorschein kommen, doch häufig noch dieselben wie vor einigen Jahrzehnten oder sogar Jahrtausenden.
Bei dieser Rückbesinnung ist die Philosophie sehr hilfreich– die Frage nach dem guten Leben ist nicht umsonst eine der zentralen Fragen seit der griechischen Antike, sie hat Unmengen von historischen Veränderungen überdauert und die Antworten sind immer wieder anders ausgefallen. Wer aber einmal die rastlosen Beschreibungen gelesen hat, mit dem Serenus, der Freund Senecas, in der römischen Antike seinem Philosophenfreund beschrieb, wie sehr er sich nach ein wenig innerer Ruhe sehnt und was er alles ausprobiert hat, um sie zu erlangen, der ahnt, dass es nicht erst Smartphones und Twitter geben musste, damit wir uns danach sehnen, sondern dass in dieser Frage eine tiefe menschliche Ambivalenz liegt – die irgendwo zwischen dem Wunsch nach Sicherheit und Bindung und dem Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit angesiedelt ist.
Als politischer Mensch mit Hang zur Nachhaltigkeit beunruhigen mich die aktuellen Entwicklungen sehr. Haben Sie eine Idee, wie sich konstruktiv mit dieser tiefen Unruhe umgehen lässt?
Für mein Empfinden gibt es keine Alternative zu einem »optimistischen« Blick auf die Welt, so wie es Marion Gräfin-Dönhoff in einem ihrer letzten Interviews einmal sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Das Optimum bedeutet ja nicht, dass wir alle einer naiv-romantischen Idee des idealen Lebens nachhängen, sondern es bedeutet, das Beste aus den gegebenen Bedingungen zu machen: Damit sind wir dann bei der Frage nach dem, was das »Gute« ausmacht und wie wir es fördern und sichtbar machen können.
Da lässt sich jeden Tag eine Menge tun, ohne dass wir uns deshalb in heilige Veganer*innen oder tugendhafte Moralapostel verwandeln müssen. Allein die Frage zu stellen, sich zu überlegen, was ist der Unterschied zwischen dem »Guten« und dem »Nützlichen«? Was würde ich tun, wenn ich dies oder jenes nicht müsste oder wenn ich alles Geld der Welt hätte? Wie kann ich meinen Handlungsspielraum erweitern und mir selbst das Gefühl von »Wirksamkeit« zurückerobern?
Das ist gemeint, wenn wir uns selbst als mündige, als autonome Individuen verstehen wollen und gleichzeitig bedeutet es, vielleicht in Anlehnung an die alten Stoiker, die eigenen Grenzen mitzudenken. Der stoische Philosoph Epiktet hat angemahnt, sich selbst immer wieder zu fragen: Was steht wirklich in meiner Macht? Was ist machbar, wofür kann und will ich die Verantwortung tragen? Solche Fragen führen vielfach dazu, die eigenen Sorgen oder Verwirrungen ein wenig zu klären und sich ihnen nicht so ausgeliefert zu fühlen – letztlich also an Gelassenheit zu gewinnen, gerade wenn es stürmisch oder kritisch wird.
Diese Form einer aktiven Gelassenheit, die mutig genug ist, hinzusehen, im »Sehen standzuhalten«, wie Karl Jaspers so schön geschrieben hat und daraus Handlungsszenarien und Standpunkte zu entwickeln, ist etwas, das wir der Welt entgegensetzen können – egal in welchem Zustand sie ist oder von welchen Menschen sie gelenkt wird.
Bildnachweise: Beitragsbild »Ponte Dom Luis I Porto« (D. Luis I bridge) in Porto, Portugal via Wikimedia | alle weiteren Fotos: M i MA/Indre Zetzsche